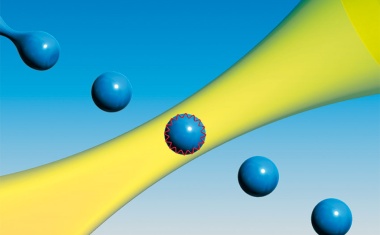• 4/2015 • Seite 28
• 4/2015 • Seite 28Von der Schneeflocke zur Lawine
Am Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos beschäftigen sich Forscher u. a. mit den Materialeigenschaften von Schnee sowie der Entstehung und Dynamik von Lawinen.
Mein erstes Ziel ist der Zauberberg.Von Davos aus geht es mit der Standseilbahn zum ehemaligen Sanatorium auf der Schatzalp, das Thomas Mann in seinem Roman verewigt hat. Für den prächtigen Jugendstilbau habe ich aber keine Zeit, denn von hier soll es 500 Meter höher gehen zum Strelapass. Dort unterhält das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF eine meteorologische Station und ein Versuchsgelände. Doch die Skilifte, die uns dorthin bringen sollen, stehen still. Weiter oben tobt ein Sturm. Für meinen Begleiter Alec van Herwijnen gehören die Launen der Natur zum täglichen Brot. Der promovierte Physiker leitet die Forschungsgruppe Lawinenbildung am SLF und hat rasch einen Plan B. Mit den Tourenski steigen wir durch den verschneiten Wald und an einer Almhütte vorbei, bis wir einen freien Hang auf etwa 2000 Meter Höhe erreichen, den van Herwijnen für geeignet hält. Hier will er mir zeigen, mit welchen Methoden er die Eigenschaften der Schneedecke untersucht.
„Ich habe schon immer gerne im Schnee gespielt“, sagt van Herwijnen und nimmt die Lawinenschaufel in die Hand. Er sticht damit senkrecht in den Schnee und schaufelt so lange Schnee beiseite, bis er einen senkrechten Schnitt durch die 1,30 Meter dicke Schneedecke freigelegt hat. Bereits auf den ersten Blick sind verschiedene Schichten zu erkennen, die er nun routiniert vermisst. Mit einem Metermaß bestimmt er die Tiefe der Schichten, mit einer Lupe Größe und Form der Schneekörner und mit einem Thermometer das Temperaturprofil. „Die Schneedecke ist wie ein Archiv der Witterung“, erklärt er und zeigt auf eine tief eingeschneite dünne Kruste: „Die ist vom 10. und 11. Januar, da hat es bis auf 2500 Meter Höhe geregnet“. Anschließend fielen 20 Zentimeter Schnee, bevor es eine Woche lang sonnig war mit sehr kalten Nächten, in denen sich Oberflächenreif gebildet hat. Unter der Lupe sind die großen kantigen Schneekristalle des Reifs zu erkennen. Da diese sich mit den seither gefallenen 60 Zentimeter Schnee nur schlecht verbinden können, ist die eingeschneite Reifschicht entscheidend für die Lawinengefahr: Spontan oder unter Belastung durch einen Skifahrer kann diese Schwachschicht kollabieren. Ist der Hang flach, macht sich das nur durch ein deutlich hörbares „Wumm“ bemerkbar. Ist der Hang aber steiler, kann die ganze Schneedecke über der Schwachschicht ins Gleiten kommen und als Schneebrettlawine abgehen.
Mit der touristischen Erschließung der Alpen, dem Bau von Verkehrswegen und Wasserkraftwerken stieg Anfang des letzten Jahrhunderts die Notwendigkeit, Lawinen und ihre Entstehung wissenschaftlich zu untersuchen. 1942 wurde daher das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung gegründet. Im Winter 1950/51 fiel so viel Schnee, dass in der Schweiz fast hundert Lawinentote zu beklagen waren. Dies führte die praktische Notwendigkeit von Lawinenschutz und -vorhersage drastisch vor Augen und löste verstärkte Forschungsanstrengungen aus. Heute ist das SLF ein interdisziplinäres Institut, dessen 140 Mitarbeiter sich mit der Entstehung und der Dynamik von Lawinen ebenso befassen wie mit den Materialeigenschaften von Schnee oder der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen. Dazu stehen ihnen Kältelabors und eine Schneemaschine zur Verfügung sowie verschiedene Versuchsfelder, in denen sie auch gezielt große Lawinen durch Sprengungen auslösen, um zum Beispiel Simulationsrechnungen mit den Beobachtungen zu vergleichen. Wintersportler kennen das SLF vor allem wegen des täglichen Lawinenbulletins, das die Lawinengefahr für alle Schweizer Bergregionen mit den Stufen 1 („gering“) bis 5 („sehr groß“) quantifiziert. Wichtige Puzzleteile für das Bulletin sind Wetterbeobachtungen und Schneeprofile, die regelmäßig an verschiedenen Punkten in der Schweiz aufgenommen werden...