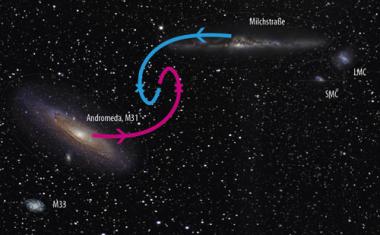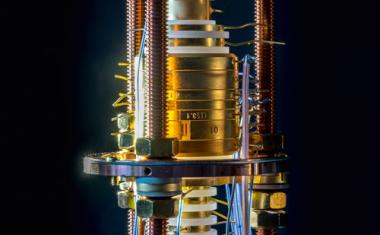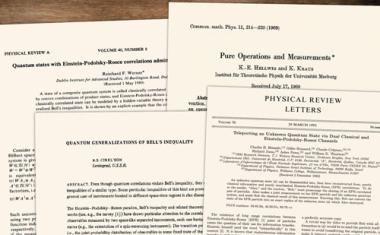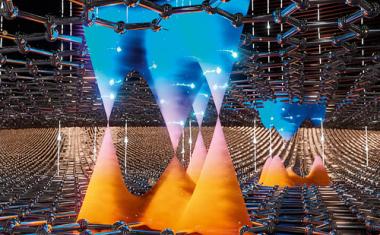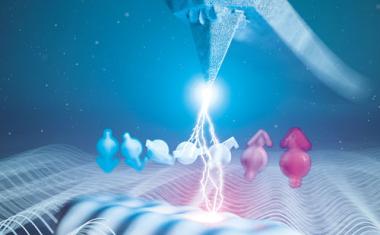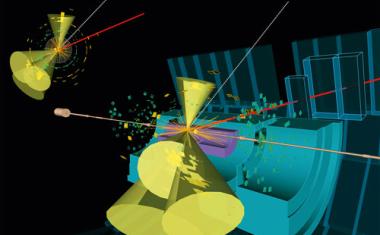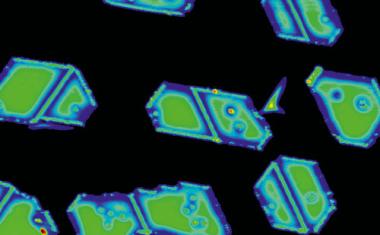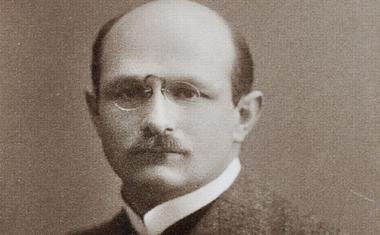DPG-Preise 2025
Studierendenstatistik
Jahresbericht der DPG
Die künstlerische Darstellung visualisiert bewegliche Ladungen in natürlich vorkommendem Doppellagen-Graphen – links ohne und rechts mit angelegtem elektrischen Feld. (Bild: Lukas Kroll, vgl. S. 59).
Ausgabe lesen