Infrarote Laserpulse erzeugen in einem nichtlinearen Kristall neue Frequenzen, indem die Frequenzen verdoppelt und summiert werden (vgl. ab S. 31, Quelle: Fabian Sibbers)


Infrarote Laserpulse erzeugen in einem nichtlinearen Kristall neue Frequenzen, indem die Frequenzen verdoppelt und summiert werden (vgl. ab S. 31, Quelle: Fabian Sibbers)
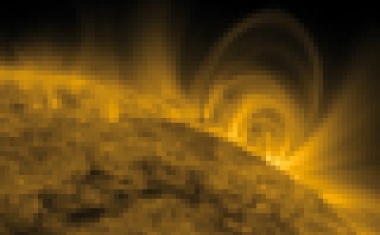 • 11/2012 • Seite 18
• 11/2012 • Seite 18In Laborexperimenten erzeugte Plasmabögen ähneln denen in der Sonnenkorona.
 • 11/2012 • Seite 20
• 11/2012 • Seite 20Strömende Quantengase geben Einblicke in Transportprozesse auf atomaren Skalen.
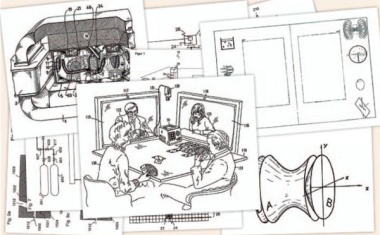 • 11/2012 • Seite 25
• 11/2012 • Seite 25Im Patentwesen sind Physikerinnen und Physiker gefragt, Praxiserfahrung und keine Scheu vor Jura vorausgesetzt.
Im Foyer des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) in München arbeitet die „Perpetual Storytelling Machine“: Gefüttert wird sie mit dem Text eines beliebigen Buches. Immer wenn ein Schlüsselwort aus den deutschen Patentschriften vorkommt, druckt sie eine passende technische Zeichnung aus. Die Druckgeschwindigkeit ist allerdings stark gedrosselt, sonst würde das Foyer von Papier überflutet.
Die Amtsbezeichnung lässt einen in Ehren ergrauten Beamten erwarten, stattdessen empfängt mich ein 34-jähriger Patentprüfer. Seine Amtsbezeichnung verrät nur, dass er die Laufbahn des höheren Dienstes eingeschlagen hat und wir uns in einer Behörde befinden. Das DPMA ist die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz in Deutschland und organisatorisch dem Bundesministerium der Justiz nachgeordnet. Dass ein Patentamt durchaus ein Pflaster für Physiker sein kann, ist dank Albert Einstein kein Geheimnis.
Carsten Winterfeldt wäre das Patentwesen auch ohne Einstein nicht fremd gewesen. „Ich bin familiär vorbelastet“, bekennt er. Sein Vater war Richter am Bundespatentgericht in München. Winterfeldt studierte drei Jahre in Würzburg, bevor er für ein Jahr nach Austin (Texas) ging, wo er seinen Master machte. Zurück in Würzburg absolvierte er die Diplomprüfungen und promovierte in experimenteller Laserphysik. „Für mich war klar, dass ich nach der Promotion nicht länger an der Uni bleibe, sondern in die Industrie wechseln möchte“, sagt er. Über einen Ingenieursdienstleister kam Carsten Winterfeldt in die Entwicklungsabteilung eines großen deutschen Automobilherstellers. Dort beschäftigte er sich mit Head-up-Displays, die Daten und Hinweise direkt in die Frontscheibe projizieren. Nach einem Jahr war für den jetzigen Patentprüfer jedoch klar: Die Aussicht, sich „bis zum Lebensende“ immer tiefer mit Head-up-Displays zu beschäftigen, war „zwar interessant, aber letztlich immer dasselbe und nicht besonders abwechslungsreich“. So kam der Beruf des Patentprüfers in den Blick. Die nötigen Voraussetzungen erfüllte Winterfeldt: Ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder technisches Studium hatte er in der Tasche, und er konnte auch die vom Patentgesetz geforderte fünfjährige berufliche Tätigkeit im Bereich der Naturwissenschaften oder Technik vorweisen, dank der Promotion in Experimentalphysik und der Arbeit in der Industrie.
Carsten Winterfeldt ist seit viereinhalb Jahren am DPMA, drei Jahre davon waren der zweistufigen Ausbildung gewidmet: In den ersten anderthalb Jahren wurde er von zwei erfahrenen Patentprüfern „on the job“ in sämtliche Aufgaben eingeführt. In der zweiten Phase musste sich der angehende Prüfer möglichst selbstständig beweisen, begleitet von einem Gruppenleiter als Coach, der im ersten halben Jahr auch verstärkt kontrollierte. ...
 • 11/2012 • Seite 31
• 11/2012 • Seite 31Vor 50 Jahren schlug die Geburtsstunde der nichtlinearen Optik.
Aus wissenschaftlicher Neugier bestrahlten Experimentatoren ab 1961 Materie mit Laserlicht und beobachteten völlig neuartige Effekte. Damit revolutionierten sie nicht nur unser Bild der Wechselwirkung von Licht und Materie, sondern hoben auch die nichtlineare Optik aus der Taufe. Als Geburtsstunde gilt die Veröffentlichung der zugrunde liegenden Theorie im Herbst 1962. Die nichtlineare Optik ist heutzutage im Laboralltag und in Anwendungen allgegenwärtig.
Für die moderne Optik waren die Sechzigerjahre eine aufregende Zeit, die bis heute unsere wissenschaftlichen Arbeiten prägt und zahlreiche, aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenkende Innovationen hervorgebracht hat. Der Laser war gerade erst entdeckt. Dieses Gerät, welches das Konzept des zehn Jahre zuvor entwickelten Masers in das optische Spektrum übertrug, galt als Lösung ohne Problem. Nur wenig später – mit Kinostart 1964 – traktierte Bösewicht Goldfinger den Geheimagenten James Bond mit einem Laser und belehrte ihn, dass der industrielle Laser sehr viele Anwendungen habe und man damit auch Metall schneiden könne. Dieser schnelle Wandel der Einschätzung des Lasers hat viel damit zu tun, dass innerhalb kürzester Zeit ein neues Gebiet der Optik entstanden war, das bis heute maßgeblich Laserlichtquellen und -anwendungen bestimmt: die nichtlineare Optik.
Nichtlineare Effekte entstehen in der Optik, wenn die Polarisation eines Materials nichtlinear vom elektrischen Feld abhängt. Aus der klassischen linearen Optik wissen wir, dass die Polarisation direkt proportional zum elektrischen Feld ist, wobei die dielektrische Suszeptibilität die verbindende Konstante darstellt. Sie ist proportional zum Quadrat des komplexen Brechungsindex, der die Absorption und Dispersion im Material bestimmt. Unsere atomare Vorstellung dieser linearen Licht-Materie-Wechselwirkung geht von Elektronen aus, die fest am Atomrumpf gebunden sind. Einfallendes Licht kann diese zu Schwingungen um ihre Ruhelage anregen. Diese Oszillationen erzeugen wie beim Hertzschen Dipol erneut Lichtstrahlung mit der Frequenz der Ladungsoszillation, solange die einfallende Lichtintensität klein genug relativ zur Coulomb-Feldstärke der äußeren gebundenen Elektronen ist.
Durch den Laser war nun eine intensive Lichtquelle verfügbar. Schon der erste Rubinlaser konnte mit Pulsen im Nanosekundenbereich eine Leistung von mehreren Kilowatt pro Quadratzentimeter erzielen. Fokussiert erreichte er den Megawatt-Bereich und erzeugte dadurch elektrische Felder von 105 Volt pro Zentimeter. Bedenkt man, dass in einem Atom mittlerer Größe, z. B. in einem Natriumatom, das Elektron am Atomrumpf mit einer Feldstärke von 109 Volt pro Zentimeter gebunden ist, wird ein solches Feld das Elektron zwar nicht aus der Atombindung lösen, aber zumindest kräftig „durchschütteln“. Als Folge davon schwingt das Elektron nicht mehr harmonisch um den Atomrumpf. Seine Schwingung enthält höhere Harmonische und damit nichtlineare Anteile, die sich auf das Licht übertragen. Daher enthält das aus dem Material austretende Licht ebenfalls Anteile mit neuen Frequenzen. Im Umkehrschluss können mehrere in ein Material einfallende Laserstrahlen mit unterschiedlichen Frequenzen Licht mit einer ungeahnten Vielfalt neuer Frequenzen erzeugen. ...
 • 11/2012 • Seite 37
• 11/2012 • Seite 37Heutzutage lassen sich hohe Harmonische bis etwa zur 1000. Ordnung erzeugen.
In einem nichtlinearen Prozess können hohe Harmonische entstehen, die durch ihre ultrakurze Pulsdauer und hohe Photonenenergie neuartige Experimente und Anwendungen eröffnen. So lassen sich beispielsweise dynamische Vorgänge in der Elektronenhülle mit einer Zeitauflösung im Femtosekundenbereich verfolgen.
Verbesserte gepulste Laser ermöglichten es ab Mitte der 1980er-Jahre, Intensitäten bis 1014 W/cm2 zu erzielen. Bei der Wechselwirkung mit einem Edelgas tauchen in den Spektren ungeradzahlige Harmonische sehr hoher Ordnung auf, die den Vorhersagen der perturbativen nichtlinearen Optik widersprechen. Bemerkenswerterweise ist die Intensität dieser hohen Harmonischen über einen weiten Bereich bis zu einem klar definierten „cut-off“ nahezu konstant. Die bis dahin in der nichtlinearen Optik verwendete Störungstheorie zur Beschreibung der Frequenzvervielfachung kann die Erzeugung hoher Harmonischer (High Harmonic Generation, HHG) nicht erklären. Das ist nicht weiter erstaunlich, da das elektrische Feld bei den dafür notwendigen Intensitäten (> 1013 W/cm2) dieselbe Größenordnung erreicht wie das Feld, in dem das Elektron im Atom gebunden ist. Daher lässt sich die Wechselwirkung zwischen Licht und Atom nicht mehr störungstheoretisch beschreiben, sondern nur mit nicht-perturbativer nichtlinearer Optik.
Bei Intensitäten ab etwa 1018 W/cm2 beginnt der Bereich der relativistischen nichtlinearen Optik, in dem das elektrische Feld des Lichts die Elektronen so stark beschleunigt, dass diese nahezu Lichtgeschwindigkeit erreichen. Relativistische Optik spielt eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung von Elektronen und Ionen sowie bei der Erzeugung ultrakurzer Impulse im harten Röntgenbereich. Hier beschränken wir uns aber auf die nicht-perturbative nichtlineare Optik.
Die Erzeugung hoher Harmonischer lässt sich semiklassisch mit dem Dreistufenmodell erklären – eine verblüffend einfache Theorie, die einen hochgradig nichtlinearen Effekt mit einfacher klassischer Physik beschreibt. Den Anstoß zu diesem Modell lieferten Corkum und Kulander Anfang der 90er-Jahre. Nach der Ionisation des Atoms propagiert das als frei anzusehende Elektron im Laserfeld. Schließlich entsteht bei der Rekombination des Elektrons Strahlung. ...
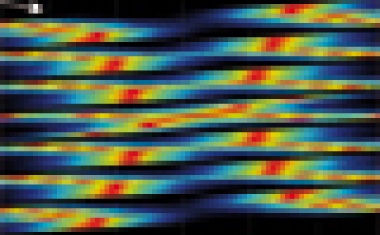 • 11/2012 • Seite 43
• 11/2012 • Seite 43Nichtlineare Lichtausbreitung und Solitonen in gekoppelten Wellenleiterstrukturen
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile: Ein eindrucksvolles Beispiel dafür liefern diskrete optische Systeme, bei denen das Zusammenspiel von vielen, vergleichsweise einfachen Grundbausteinen zu erstaunlich komplexen optischen Effekten führt, wie sie in homogenen, kontinuierlichen Materialien nicht vorkommen. Kommen dann auch noch Nichtlinearitäten ins Spiel, so ist das Spektrum möglicher Phänomene noch reichhaltiger, wie der Nachweis von Solitonen, diskreten optischen Wirbeln oder „Lichtkugeln“ in den letzten Jahren gezeigt hat.
Betrachtet man ein herkömmliches Medium, das in allen drei Raumrichtungen weitgehend homogen ist, so lassen sich darin auftretende optische Phänomene im Rahmen einer kontinuierlichen Theorie beschreiben. Insbesondere ist es damit möglich, die Ausbreitung von Licht und die damit einhergehende Beugung und Dispersion mit hoher Genauigkeit vorherzusagen. Verglichen mit homogenen Medien erweitern mikro- und nano-optische (sog. mesoskopische) Systeme die Möglichkeiten beträchtlich, Licht und seine Propagation gezielt zu kontrollieren. In diesen Systemen ist Licht typischerweise in wohldefinierten Raumbereichen lokalisiert, beispielsweise in Mikroresonatoren, photonischen Kristallen oder Wellenleitern. Da das Licht sich nun nicht mehr an jedem Punkt des optischen Mediums aufhalten kann, wird es gewissermaßen diskretisiert.
Eine Vielzahl solcher physikalischer Systeme, sowohl natürliche als auch künstliche, ist trotz eines insgesamt eher komplexen Aufbaus durch das Wechselspiel relativ ähnlicher Grundkomponenten gekennzeichnet. So bestehen organische Makromoleküle häufig aus einer Vielzahl fast gleicher Untereinheiten, sind Halbleiter-Supergitter aus einer Sequenz identischer Quantentröge aufgebaut oder ist ein elektrisches Netz als Ensemble schwach wechselwirkender Einzelschaltkreise aufzufassen. Oftmals sind die entsprechenden kleinen Einheiten gut verstanden und lassen sich mithilfe weniger Parameter und einfacher Differentialgleichungen sehr genau beschreiben. Das Gesamtsystem kann jedoch trotz verhältnismäßig schwacher Wechselwirkung zwischen den diskreten Elementen eine faszinierende Komplexität zeigen.
Diesen qualitativen Unterschied zu kontinuierlichen Systemen muss auch die theoretische Beschreibung berücksichtigen. Das Konzept des diskreten Systems trägt diesen Gegebenheiten Rechnung und beruht auf der Analyse des Anregungs- und Energietransfers zwischen diskreten Einheiten. Die Einfachheit und Klarheit dieser mathematischen Beschreibung hat grundlegende theoretische Analysen mit zum Teil überraschenden Ergebnissen ermöglicht. So wird insbesondere deutlich, dass sich diskrete Systeme ungeachtet ihrer Unterschiede mithilfe ähnlicher Modelle beschreiben lassen, bei denen die Antwort des Gesamtsystems auf eine spezifische Anregung letztlich nur von den Eigenschaften der diskreten Einheitszellen und der Wechselwirkung der Zellen untereinander abhängt. Daher ist es möglich, Phänomene, die gemeinhin mit einem bestimmten diskreten System assoziiert sind, mathematisch auf andere diskrete Systeme abzubilden, um sie dort gegebenenfalls auch experimentell untersuchen zu können. ...
 • 11/2012 • Seite 49
• 11/2012 • Seite 49Das „Observatorium“ der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR), eine Pionierleistung der Wissenschaftsarchitektur, war Vorbild für moderne Forschungsbauten.
Als die Physikalisch-Technische Reichsanstalt vor 125 Jahren am 1. Oktober 1887 ihre Tätigkeit aufnahm, geschah dies zunächst in angemieteten Räumen. Da der vorgesehene Forschungscampus „auf den Wiesen vor Charlottenburg“ erst noch zu erschließen war, musste die PTR fast ein Jahrzehnt Gastrecht genießen: Die Physikalische Abteilung nutzte zunächst Räumlichkeiten im Privatlaboratorium des Schweizer Physikers Johannes Pernet in Berlin-Tiergarten, bevor sie im April 1888 Labors im Untergeschoss des nordwestlichen Flügels der Technischen Hochschule Charlottenburg bezog; dort war bereits die Technische Abteilung der Anstalt untergebracht. Ende 1891 konnte die Physikalische Abteilung schließlich ihr neu erbautes Hauptgebäude, das „Observatorium“, auf dem Gelände in Charlottenburg beziehen.
Das Observatorium war nicht nur das erste Gebäude des zu errichtenden Forschungscampus, dessen Vollendung sich bis 1896 hinziehen sollte, sondern auch dessen Herzstück und ein „Schmuckkästchen“. Die Bezeichnung „Observatorium“ mag daher rühren, dass Hermann von Helmholtz, der erste Präsident der PTR, in einer von ihm und Werner von Siemens verfassten Denkschrift von der „Errichtung eines, den Sternwarten ähnlich organisierten, physikalischen Observatoriums“ spricht und dabei wohl das Observatoire de Paris vor Augen hatte, den Ursprungsort der Metrologie. Dort wurde der Null-Meridian vermessen und nach der Französischen Revolution daraus die Längeneinheit Meter abgeleitet. Allerdings wurden im 19. Jahrhundert nicht nur astronomische Institute als Observatorien bezeichnet, sondern auch andere Einrichtungen, die Experimente „observierten“ .
Das Observatorium ragte unter den PTR-Gebäuden heraus. Die insgesamt sieben Gebäude auf dem etwa 3,5 Hektar großen Gelände, inklusive einer repräsentativen Villa für den Präsidenten, waren dem Observatorium untergeordnet, sowohl hinsichtlich ihrer architektonischen Gestaltung als auch bezüglich der Lage. So waren sie so weit entfernt, dass messtechnische Störungen mechanischer oder elektromagnetischer Art und selbst der Schattenwurf minimiert wurden. Das Observatorium war auch in der Mitte des Geländes, das als Landschaftsgarten gestaltet wurde, platziert, wodurch sich Störungen durch den Straßenverkehr weitgehend separieren ließen.
Planer der PTR und damit auch des Observatoriums war zunächst der Architekt Paul Spieker, unter dessen Leitung bereits das Physikalische Institut der Friedrich-Wilhelms Universität am Reichstagsufer und das Astrophysikalische Observatorium auf dem Potsdamer Telegrafenberg entstanden waren. Die eigentliche Bausausführung leitete Theodor Astfalck, ein Kollege Spiekers aus der Bauabteilung des Reichsministeriums des Innern. Astfalck hatte sich zuvor durch Besuche verschiedener Laboratorien in Dresden, München, Paris, Wien und Straßburg über „wesentliche Fortschritte in der Errichtung wissenschaftlicher Laboratorien, namentlich im Gebiet der Elektrotechnik“ informiert. Die Baugeschichte der Reichsanstalt war somit Teil der „institutionellem Revolution der deutschen Physik“ im ausgehenden 19. Jahrhundert. Dabei wurden im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts praktisch an allen deutschen Universitätsstandorten neue und moderne Physikinstitute errichtet, die nicht nur für die physikalische Forschung einen gewaltigen Modernisierungsschub bedeuteten, sondern auch den spezifischen Bedingungen des Laborbetriebs und der physikalischen Erkenntnisgewinnung Rechnung trugen. Sie stehen damit am Beginn funktionaler Wissenschaftsarchitektur. Unter diesen Neubauten ragen das 1878 in Betrieb genommene und für Helmholtz gebaute Physikinstitut am Berliner Reichstagsufer sowie das 1882 eröffnete Physikalische Institut der neuen Reichsuniversität Straßburg heraus. Beide waren gleichermaßen wissenschaftliche wie politische Prestigebauten und ersteres wurden von Zeitgenossen keineswegs zufällig als „Palast der Physik“ bezeichnet. Darüber hinaus waren sie auch in wissenschaftlicher Hinsicht als Modellinstitute konzipiert und hatten für damalige Verhältnisse gewaltige Baukosten verschlungen – im Falle des Berliner Institut mehr als 1,5 Millionen Reichsmark; beim Straßburger Institut immer noch fast 600 000 Reichsmark. ...
Interview mit Monika Bessenrodt-Weberpals