Wellenleiter können dank topologischer Prinzipien Photonen verlustfrei übertragen. (vgl. S. 29)


Wellenleiter können dank topologischer Prinzipien Photonen verlustfrei übertragen. (vgl. S. 29)
Zu: „Optische Komplementarität“ von M. Rang, O. Passon und J. Grebe-Ellis, März 2017, S. 4
Zu „Sonniges Pflaster“ von Kerstin Sonnabend, März 2017, S. 14
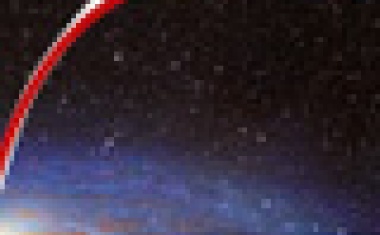 • 5/2017 • Seite 18
• 5/2017 • Seite 18Die Form der Rotationskurven von Spiralgalaxien bei hoher Rotverschiebung deutet darauf hin, dass in frühen Epochen Galaxien von der sichtbaren Materie dominiert werden.
 • 5/2017 • Seite 20
• 5/2017 • Seite 20Die Quantisierung der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit lässt sich in Ketten von Goldatomen selbst bei Zimmertemperatur nachweisen.
 • 5/2017 • Seite 24
• 5/2017 • Seite 24Die Digitalisierung hat das Publikationswesen radikal verändert. Die Open-Access-Bewegungwird immer stärker, Fragen des Urheberrechts sind dabei neu zu klären.
Vor 20 Jahren gehörte der regelmäßige Gang in die Universitätsbibliothek zum Studium noch dazu wie Vorlesungen und Übungsgruppen: Fachbücher musste man ausleihen und nach Hause schleppen, Fachartikel mühsam in einem unübersichtlichen Tool der Bibliothek suchen. Wer Glück hatte, konnte die gewünschte Zeitschrift im Regal suchen und die interessanten Artikel kopieren. Wer Pech hatte, musste sie per Fernleihe bestellen. Die heutige Realität ist eine andere: Dank Internet und Digitalisierung stehen unzählige Artikel und Bücher online zur Verfügung – häufig sogar kostenlos. Dadurch können Studierende und Wissenschaftler bequem vom eigenen Rechner auf wichtige Journals zugreifen und im Volltext durchsuchen. Der Zugang zu Wissen ist schnell und einfach möglich – und doch ist das erst der Anfang: Ziel vieler Initiativen ist es, sämtliche wissenschaftlichen Ergebnisse in digitaler Form für alle Nutzer ohne finanzielle, technische oder rechtliche Barrieren zugänglich und nutzbar zu machen, also in Form von Open Access (OA).
Als ein Meilenstein dieser Bewegung in Deutschland gilt die „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ aus dem Jahr 2003.1) Diese verdeutlicht die Bedeutung des Internets zur Verbreitung von wissenschaftlichem Wissen und kulturellem Erbe und kommt zu dem Schluss, dass die damit verbundenen Entwicklungen das Wesen des wissenschaftlichen Publizierens erheblich verändern werden. Die Berliner Erklärung verfolgt das Ziel, „das Internet als Instrument für eine weltweite Basis wissenschaftlicher Kenntnisse und menschlicher Reflektion zu fördern.“ Denn unsere Aufgabe, Wissen weiterzugeben, sei nur halb erfüllt, wenn diese Informationen für die Gesellschaft nicht in umfassender Weise und einfach zugänglich seien. Zu den ersten Unterzeichnern der Erklärung gehörten in Deutschland die Fraunhofer- und Max-Planck-Gesellschaft, der Wissenschaftsrat, die Hochschulrektorenkonferenz, die Leibniz- und Helmholtz-Gemeinschaft sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Heutzutage haben bereits über 500 Institutionen weltweit die Erklärung unterschrieben.
Doch der Übergang zu Open Access geht langsam voran: Seit der Berliner Erklärung sind Jahre vergangen, und dennoch liegt der Anteil reiner Open-Access-Veröffentlichungen immer noch bei nur 15 Prozent – obwohl fast 90 Prozent der Wissenschaftler überzeugt sind, dass es vorteilhaft für ihr Forschungsfeld und die Arbeitsweise ihrer Community ist, ihre Artikel frei zugänglich zu publizieren. Zu diesem Ergebnis kam die groß angelegte „Study of Open Access Publishing“ (SOAP), die im Rahmen des siebten Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Kommission gefördert und vom CERN koordiniert wurde.2) Darin wurden die Antworten von fast 40 000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aller Disziplinen weltweit ausgewertet, die mindestens eine Publikation in einer Peer-Review-Zeitschrift in den letzten fünf Jahren vor der Umfrage veröffentlicht hatten. Mehr als 3000 Antworten stammten von Forschern aus der Physik oder Astronomie...
 • 5/2017 • Seite 29
• 5/2017 • Seite 29Topologische Methoden erklären exotische Materiezustände und bahnen neue Wege in der Photonik.
Lange Zeit galt die Topologie als reines Teilgebiet der Mathematik, das sich allgemein mit Eigenschaften von Strukturen befasst, die unter stetigen Verformungen erhalten bleiben. Doch Topologie ermöglicht nicht nur einen neuen Blick auf abstrakte Strukturen, sondern hat mittlerweile auch Einzug in die Physik gehalten. Topologische Methoden erlauben neue Erkenntnisse bei exotischen Phasen der Materie und versprechen faszinierende Durchbrüche bei der optischen Kommunikation.
Was verbindet die sieben Brücken in Königsberg, Schwarze Löcher und Krawatten? All dies sind Beispiele dafür, wie sich grundlegende Fragen mit topologischen Mitteln beantworten lassen. Topologie erklärt, weshalb sich kein Rundweg über die sieben Königsberger Brücken finden lässt, dass Schwarze Löcher im Universum eine Singularität besitzen müssen und wieso es genau 266 682 Möglichkeiten gibt, eine Krawatte zu binden [1].
Die Topologie ist als eigene mathematische Disziplin noch vergleichsweise jung. In einfachen Worten befasst sie sich mit den Eigenschaften geometrischer Gebilde, die bei „elastischen Verformungen“ wie Dehnen, Stauchen, Verbiegen oder Verzerren erhalten bleiben. Man sagt, die betreffenden Gebilde seien topologisch äquivalent oder „homöomorph“: Anschaulich gesagt bleiben Randpunkte weiterhin Randpunkte, und Kreuzungen bleiben Kreuzungen, selbst wenn sich Winkel und Abstände ändern (Abb. 1). Außerdem bleibt ein geschlossener Linienzug als solcher erhalten. ,,Auf dem Rand liegend”, ,,innen”, ,,außen”, ,,sich schneidend”, ,,geschlossen” sind topologisch invariante Eigenschaften. Topologie formalisiert den Begriff „Nähe“, ähnlich wie die algebraischen Strukturen die Rechengesetze formalisieren. Ziel ist es dabei, eine Menge von Objekten zu klassifizieren, d. h. topologisch äquivalente Objekte in Klassen zusammenzufassen...
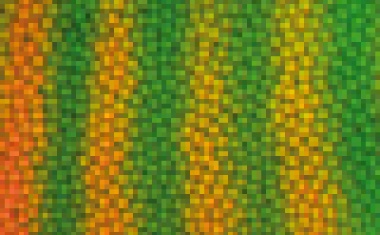 • 5/2017 • Seite 35
• 5/2017 • Seite 35In der Biologie führen mechanochemische Prozesse zu Selbstorganisation und Strukturbildung in Zellen und Geweben.
Der stetige technologische Fortschritt ermöglicht es, immer kompliziertere technische Maschinen wie den Large Hadron Collider am CERN oder den Airbus A380 zu bauen. Dennoch bleiben lebende Organismen wesentlich komplexer als alle jemals von Menschen gebauten Maschinen. Insbesondere assemblieren sich biologische Organismen selbst und bilden völlig autonom aufwändige Strukturen aus. Ein Ziel biophysikalischer Forschung ist es, die physikalischen Grundlagen dieser Prozesse der Selbstorganisation besser zu verstehen.
Die meisten mehrzelligen Organismen haben ihren Ursprung in einer einzigen Zelle, der so genannten Eizelle. Nach der Befruchtung teilt sich diese wiederholt, und aus den vielen entstandenen Zellen bildet sich Gewebe aus. Zwei verschiedene Prozesse sind dafür von Bedeutung: Einerseits sorgen Musterbildungsprozesse dafür, dass sich Signalproteine innerhalb des Embryos asymmetrisch verteilen, und etablieren dadurch ein „embryonales Koordinatensystem“ (Abb. 1). Andererseits verformt sich Gewebe im Embryo kontinuierlich mittels autonom erzeugter mechanischer Kräfte und Spannungen, um die eigentliche Struktur und Form zu erreichen. Dieser Prozess der Entstehung von biologischer Form heißt Morphogenese (Abb. 2). Musterbildung und Morphogenese lassen sich bis zu einem gewissen Grad in der Entwicklungsbiologie getrennt untersuchen [1, 2]. Eine Reihe neuer Studien deutet jedoch darauf hin, dass beide Prozesse im Wachstum lebender Organismen häufig untrennbar verwoben und nur gemeinsam zu betrachten sind [3].
Systeme, in denen regulative und mechanische Prozesse der Muster- und Formgebung verwoben sind, werden als mechanochemisch bezeichnet. Ein Beispiel hierfür sind mechanochemische Selbstorganisationsprozesse in Kolonien von Escherichia Coli-Bakterien (Abb. 3). Diese Bakterien sind mobil und bewegen sich mittels eines Bündels rotierender Flagella gerichtet vorwärts. Außerdem können sie sich aktiv entlang eines Konzentrationsgradienten von Nährstoffen und in Richtung erhöhter Konzentrationen spezieller Botenstoffe bewegen – eine Eigenschaft, die Chemotaxis genannt wird [4]. Dabei scheiden die E. Coli-Bakterien einen dieser Botenstoffe selbst aus. Als Folge davon bewegen sich mehr Bakterien auf Regionen zu, in denen die Konzentration der Botenstoffe erhöht ist. Gleichzeitig steigt aber die Botenstoffkonzentration in Regionen erhöhter Bakteriendichte an, sodass sich spontan eine räumlich inhomogene Konzentration von Bakterien und Botenstoffen einstellt. Verlieren die Bakterien die Fähigkeit, sich aktiv fortzubewegen oder Botenstoffe zu produzieren, verschwinden diese Muster: Ihre Bildung hängt sowohl von einem regulativen Prozess – der Produktion und Ausscheidung des Botenstoffs – als auch von einem mechanischen Prozess – dem aktiven Fortbewegen in Richtung erhöhter Botenstoffkonzentration – ab und wird deshalb als „mechanochemisch“ bezeichnet [3, 5]...