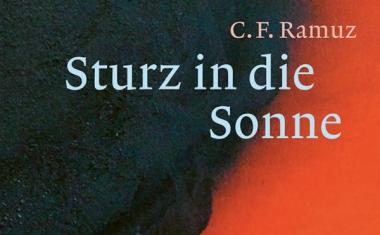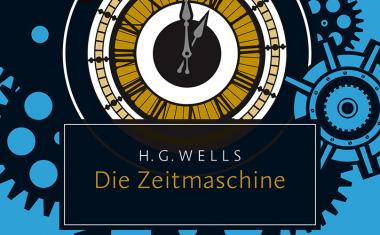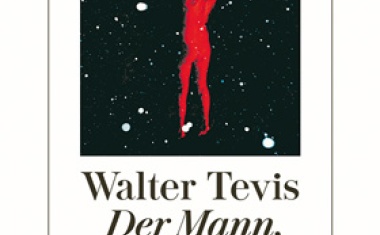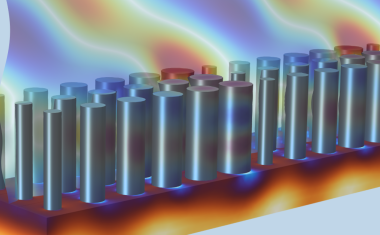Aniara
Harry Martinson: Aniara – Eine Revue über den Menschen in Raum und Zeit, Guggolz Verlag, Berlin 2025, geb., 179 S., 24 Euro, ISBN 9783945370513
Harry Martinson
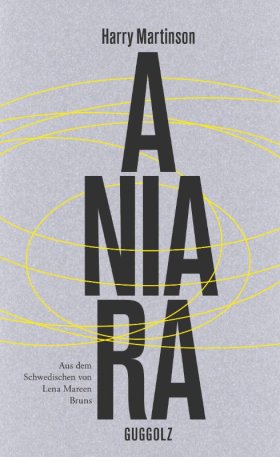
„Aniara. Eine Revue über den Menschen in Zeit und Raum“ ist ein Versepos des schwedischen Dichters Harry Martinson (1904 – 1978) aus dem Jahr 1956. Martinson erzählt darin, wie das Raumschiff Aniara, das 8000 Menschen von der zerstörten Erde auf den Mars evakuieren soll, nach einem Ausweichmanöver vom Kurs abkommt. Danach fliegt es in Richtung des Sternbilds Lyra, ohne jede Hoffnung, sein Ziel noch erreichen zu können.
Trotz des auf den ersten Blick einfachen Plots ist Aniara ein vielschichtiges und immer noch sehr lesenswertes Werk. Martinson bringt darin seine Sorge um die Menschheit und die Erde als Ganzes angesichts der Bedrohung durch Nuklearwaffen und Umweltzerstörung zum Ausdruck.
Zentrale „Figur“ ist die Mima, eine Art künstliche Intelligenz, welche die Erinnerung an die Erde bewahrt, und der Mimarob, d. h. der Mensch, der für ihren Betrieb zuständig ist. Angesichts der Furcht vor der Leere des Alls bilden sich unter den Passagieren verschiedene Kulte heraus, und der Chefpilot etabliert ein autoritäres Regime. Die empfangenen Bilder von den Verheerungen auf der Erde bringen die Mima zum Verstummen und entziehen den Menschen an Bord den Trost durch die von ihr erzeugten Bilder.
Aniara ist ein ungewöhnliches lyrisches Werk, das nichts an Aktualität eingebüßt hat. Martinson erhielt dafür 1974 den Literatur-Nobelpreis, es gibt unter anderem eine Opernversion (1959) und eine Verfilmung (2019). In Schweden ist der Versepos längst Schulstoff, im deutschen Sprachraum aber bestenfalls ein Geheimtipp. Kein Wunder, die bislang einzige deutsche Übersetzung erschien 1961 und stammte vom den in Schweden lebenden Dirigenten Herbert Sandberg.
Die Skandinavistin Ulrike Nolte (jetzt Nolte-Raimer) legte eine umfangreiche Teilübersetzung vor, für die sie 2003 einen Förderpreis für literarische Übersetzung erhielt. Leider wurde daraus bislang keine vollständige Buchausgabe.
Sandbergs Übersetzung ist nach wie vor lesbar, klingt für heutige Ohren aber oft pathetisch, und ist eine antiquarische Rarität. Ulrike Nolte gelingt es, Satzmelodie, Versmaß und oft auch die Reime des Originals zu erhalten und erreicht damit eine sehr gut lesbare wie nachvollziehbare Nachdichtung.
Die nun vorliegende Neuübersetzung stammt von Lena Mareen Bruns, Autorin und Übersetzerin für schwedische Literatur in Berlin. Bei ihr vermisse ich oft eine zwingende Lesemelodie und die Reime. Einige Strophen geraten unnötig verschachtelt oder sprachlich dunkel.
Hier ein vergleichendes Beispiel aus Gesang 39:
Doch hier, wo uns das Schicksal einen Kurs
nach hyperbolischen Gesetz verordnet hat,
kann die Entdeckung niemals fruchtbar werden,
Hier ist sie bloß ein Theorem.
(Nolte 2002)
Aber hier, schicksalsgebunden durch unseren
Kurs unter dem Gesetz der Hyperbel,
konnte ihre Entdeckung niemals
fruchten, außer in der Theorie.
(Bruns 2025)
Hier erweist sich die freiere Nolte-Übersetzung als flüssiger lesbar, während Bruns die Wortstellung des Originals beizubehalten versucht. Hier zeigt sich prototypisch das Dilemma zwischen Lesbarkeit und einer wie auch immer gearteten Übersetzungstreue. Lyrik erfordert hier so gut wie immer Kompromisse und kreative Lösungen. Während bei Bruns auch die literarische Figur der Hyperbel durchscheint – durchaus im Einklang mit Martinsons Ansatz, die zwei Kulturen in Kontakt zu bringen – setzt Nolte auf eine mathematisch gebräuchlichere Wendung.
Martinson hätte allerdings kaum den Plural „Noven“ für das gebräuchlichere „Novae“ vorgezogen (Gesang 55). Denn der hierzulande vor allem als Naturdichter bekannte Autor hat sich ebenso intensiv wie kritisch mit Naturwissenschaft und Technik auseinandergesetzt.
Die entsprechenden Gedichte liegen jedoch nur in wenigen Fällen auf Deutsch vor, etwa in der Gedichtanthologie Die Henker des Lebenstraumes (Volk und Welt, Berlin 1973). wo sich das Gedicht „Das innere Licht“ (Det inre ljuset, 1971) findet, das die Prozesse im Inneren von Atomen thematisiert.
Im Zusammenhang mit Martinsons Beschäftigung mit den Naturwissenschaften sind auch der Essay-Band Gyro und Doriderna, der Versuch einer Fortsetzung von Aniara, interessant. Die beiden posthum erschienen Bände liegen allerdings nur auf Schwedisch vor.
In der deutschen Neuausgabe fehlt leider ein Hinweis darauf, dass das eindringliche Vorwort von Martinson aus dem Jahr 1974 stammt. Der Anhang bietet einen Zeitungsartikel des schwedischen Schriftstellers Alex Schulman, der überhaupt nicht erhellend ist und der komplexen Persönlichkeit Martinsons nicht gerecht wird. Da wären ein aufschlussreicherer Anhang oder Anmerkungen der Übersetzerin wünschenswert gewesen.
Die überfällige Neuübersetzung von „Aniara“ nach fast 65 Jahren ist nichtsdestotrotz eine beeindruckende Leistung und eine willkommene verlegerische Tat.
Alexander Pawlak
Weitere Informationen
- Verlagsseite zum Buch
- Übersetzungbeispiele von Ulrike Raimer-Nolte (unten auf der Webseite)
- Bibliographische Hinweis für die Übersetzung von Herbert Sandberg (1961)
- Harry Martinson - Poetry (nobelPrize.org) [Gedichtbeispiele auf Egnlisch]
- Weitere Rezensionen aus dem Bereich Science-Fiction
Sekundärliteratur
- Ulrike Nolte, Schwedische 'Social Fiction'. Die Zukunftsphantasien moderner Klassiker der Literatur von Karin Boye bis Lars Gustafsson, Monsenstein und Vannerdat, Münster 2001 (Auszüge)
- Philipp Martin, Das Schicksal der Erde : Katastrophenzukünfte in skandinavischer Science Fiction des Anthropozäns, Rombach Wissenschaft, Baden-Baden 2022