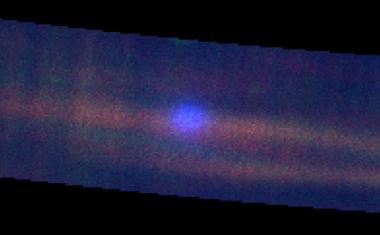Fliegende Sternwarte in Neuseeland
SOFIA beobachtet zum dritten Mal den Südhimmel.
Die fliegende Sternwarte SOFIA ist nach 2013 und 2015 zum dritten Mal in Neuseeland unterwegs. Am 6. Juni landete das Flugzeug auf dem Flughafen von Christchurch, am 9. Juni startet das „Stratosphären-
Abb.: Das Ferninfrarot-Spektrometer GREAT. (Bild: DLR)
Mit diesen Instrumenten lassen sich insbesondere Molekül- und Staubwolken in Gebieten erforschen, in denen neue Sterne und Planetensysteme entstehen. Dabei werden die Wissenschaftler vor allem die Große und die Kleine Magellansche Wolke, sowie Materiebewegungen im Zentrum unserer Milchstraße ins Visier nehmen, um die Sternentstehungsgebiete dieser unterschiedlich strukturierten Galaxien zu vergleichen.
Mit den neuen Instrumenten lasse sich die Gesamtdynamik der Sternentstehung im Detail untersuchen, so Alois Himmes, SOFIA-
Mehr als hundert Mitarbeiter, darunter Wissenschaftler, Piloten, Ingenieure, Wartungs- und Sicherheitspersonal, sind bis Ende Juli in Christchurch. SOFIA nutzt die langen Winternächte in Neuseeland, da während dieser Zeit die Wasserdampfkonzentration in der irdischen Atmosphäre sehr viel geringer ist als in unserem Sommer auf der Nordhalbkugel. Denn schon kleinste Mengen an Wasserdampf in der Luft können die Infrarotstrahlung aus dem All verschlucken, sodass diese nicht mehr von den Spektrometern gemessen werden kann.
Erstmals fliegt in Neuseeland neben GREAT auch die verbesserte Version upGREAT des Instruments, das statt einem gleich 14 Detektoren gleichzeitig betreibt. Diese sind auf zwei Arrays verteilt und können wesentlich schneller eine Molekülwolke abscannen. „Mit upGREAT erhöht sich die Leistungsfähigkeit und die Beobachtungseffizienz unseres Instruments in etwa um das Zehnfache, und neue, bislang unerforschte Frequenzbereiche werden erschlossen“, erläutert Rolf Güsten, der Leiter des GREAT- und upGREAT-
Zum ersten Mal erkundet FIFI-LS die Südhemisphäre. Dieses Instrument mit zwei Detektorarrays misst bei deutlich mehr Wellenlängen als GREAT und kann schneller großflächige Kartierungen ausgedehnter Molekülwolken vornehmen. FIFI-LS wird diesmal insbesondere die Elemente Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff in Sternentstehungsgebieten und im interstellaren Medium sowohl in unserer Milchstraße aber auch in anderen entfernteren Galaxien beobachten. „Damit können wir erstmals eine detailgetreue Inventur der Materie in der Umgebung des galaktischen Zentrums durchführen“, erläutert Alfred Krabbe, Leiter des FIFI-LS-
DLR / RK