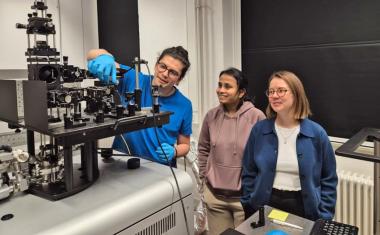Grüner Wasserstoff auf Knopfdruck
Ein einziges Molekül kann Sonnenlicht aufnehmen, Energie speichern und Wasserstoff herstellen.
Ulmer und Jenaer Forschende haben ein System entwickelt, das die lichtgetriebene Herstellung von Wasserstoff zu jeder Tages- und Jahreszeit ermöglicht. Das neue System macht sogar die Speicherung von Lichtenergie möglich. So kann die Produktion des grünen Wasserstoffs nachfrageorientiert starten. Zukünftige Anwendungen reichen von der klimafreundlichen Strom- und Wärmeerzeugung bis zu solarbetriebenen Wasserstoff-Tankstellen. Möglich wurde dieser Erfolg mit einem Einzelmolekülkatalysator, der an den Universitäten Ulm und Jena entwickelt wurde.

Frühere Modelle zur Wasserstoffherstellung beruhten oft auf der Kopplung mehrerer Komponenten wie Photovoltaik-Zellen, Batterien und Elektrolyseuren. Dabei summieren sich die Energieverluste jedoch bei jedem Schritt; die Wasserstoffproduktion ist wenig effizient. Im Gegensatz dazu basiert die Ulmer Alternative auf einem einzigen Molekül, das Sonnenlicht aufnehmen, Energie speichern und Wasserstoff herstellen kann. In dieser kompakten Einheit wird also die räumliche und zeitliche Trennung dieser Schritte möglich. „Lichteinstrahlung führt in unserem Molekül zur Ladungs-Trennung und Elektronen-Speicherung – im Ergebnis entsteht ein flüssiger, leicht speicherbarer Treibstoff. Die bedarfsgerechte Erzeugung des gasförmigen Wasserstoffs wird durch die Zugabe einer Protonen-Quelle erreicht“, sagt Carsten Streb von der Universität Ulm.
Die Forschenden haben die Leistungsfähigkeit ihres Systems mit verschiedensten Analysemethoden überprüft. Im Ergebnis zeigt die molekulare Einheit eine exzellente chemische und photochemische Stabilität. „Der modulare Aufbau des Systems ermöglicht chemische Veränderungen und eine Optimierung des Gesamtsystems“, sagt Sebastian Amthor, der an der Universität Ulm promoviert hat und nun in Spanien forscht. In Zukunft soll das Modell hochskaliert werden und somit als Blaupause für dezentrale Energiespeicher dienen. Wichtige Strukturanalysen und optisch-spektroskopische Arbeiten, die die Antwort des Katalysators auf Licht beschreiben, wurden am Zentrum für Energie und Umweltchemie der Universität Jena durchgeführt. Dabei kam unter anderem die hochauflösende Massenspektrometrie zum Einsatz. „Erst mit diesem Gerät war es möglich, die Strukturen der neuen molekularen Katalysatoren im Detail zu bestimmen“, betonen die Jenaer Wissenschaftler Ulrich S. Schubert und Benjamin Dietzek-Ivanšić.
Entwickelt wurde das photochemische System im Zuge des Transregio-Sonderforschungsbereichs TRR 234 CataLight. In dem mit zehn Millionen Euro geförderten Verbundprojekt nehmen sich Forschende der Universitäten Ulm und Jena die Photosynthese zum Vorbild und entwickeln neue Materialien für die Energiewandlung – ein Beispiel sind künstliche Chloroplasten für die Wasserstoffherstellung.
U. Ulm / JOL
Weitere Infos
- Originalveröffentlichung
S. Amthor et al.: A photosensitizer–polyoxometalate dyad that enables the decoupling of light and dark reactions for delayed on-demand solar hydrogen production, Nat. Chem., online 27. Januar 2022; DOI: 10.1038/s41557-021-00850-8 - Zentrum für Energie und Umweltchemie (CEEC Jena), Universität Jena
- Institut für Anorganische Chemie I, Universität Ulm