Humus für Quantenpunkte
Optimierter Beschichtungsprozess lässt Quantenpunkte besser wachsen.
Quantenpunkte könnten eines Tages die Basis-Informationseinheiten von Quantencomputern bilden. Forscher der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und der Technischen Universität München (TUM) haben das Herstellungsverfahren für diese winzigen Halbleiter-Strukturen entscheidend verbessert, zusammen mit Kollegen aus Kopenhagen und Basel. Die Quantenpunkte werden auf einem Wafer, einer dünnen Halbleiterkristallscheibe, erzeugt. Bisher war die Dichte der Strukturen darauf nur schwer zu kontrollieren. Nun können die Wissenschaftler gezielt bestimmte Anordnungen erzeugen – ein wichtiger Schritt in Richtung eines anwendbaren Bauteils, das eine Vielzahl von Quantenpunkten besitzen müsste.
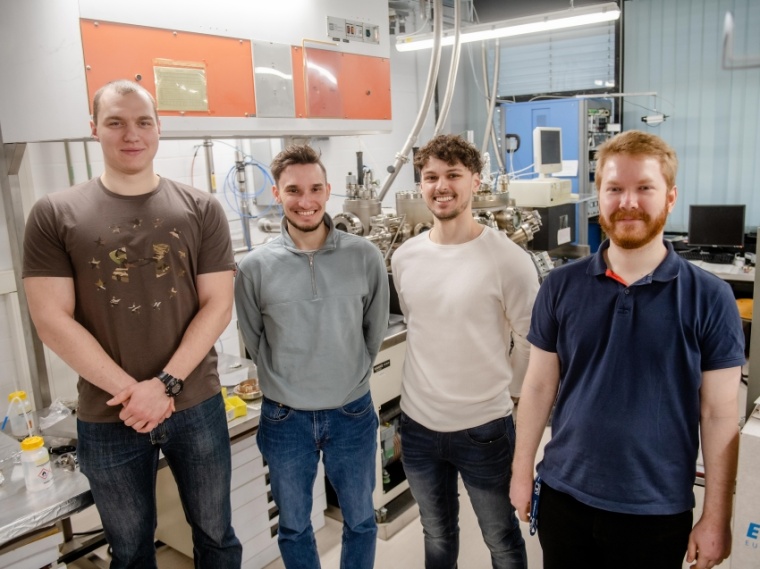
Für die Arbeiten kooperierte eine Gruppe um Nikolai Bart, Andreas Wieck und Arne Ludwig vom RUB-Lehrstuhl für angewandte Festkörperphysik mit dem Team um Christian Dangel und Jonathan Finley von der TUM-Arbeitsgruppe Halbleiter-Nanostrukturen und -Quantensysteme sowie mit Kollegen der Universitäten Kopenhagen und Basel.
Bei Quantenpunkten handelt es sich um eng abgegrenzte Bereiche in einem Halbleiter, in die sich zum Beispiel ein einzelnes Elektron einsperren lässt. Von außen kann dieses etwa mit Licht manipuliert werden, sodass sich Informationen in dem Quantenpunkt einspeichern lassen. Die Forscher aus Bochum sind Experten für die Herstellung von Quantenpunkten. Sie erzeugen die Strukturen auf einem Wafer aus einem Halbleitermaterial, der etwa so groß wie ein Bierdeckel ist. Die Quantenpunkte haben nur einen Durchmesser von etwa dreißig Nanometern.
„Unsere Quantenpunkte sind früher wie die Pilze im Walde gewachsen“, schildert Andreas Wieck die Ausgangssituation. „Wir wussten zwar, dass sie irgendwo auf dem Wafer entstehen würden, aber nicht wo genau.“ Für ihre Experimente mit den Quantenpunkten suchten sich die Forscher dann einen geeigneten Pilz im Wald aus.
In verschiedenen Vorarbeiten hatte das Team bereits versucht, das Wachstum der Quantenpunkte auf dem Wafer zu beeinflussen. Die Physiker hatten den Wafer an einzelnen Punkten mit fokussierten Ionen bestrahlt und so Defekte im Halbleiter-Kristallgitter erzeugt. Diese wirkten wie Kondensationskeime und provozierten das Wachstum von Quantenpunkten. „Aber genau wie Zuchtpilze etwas fade schmecken und Waldpilze hingegen super, waren die so erzeugten Quantenpunkte qualitativ nicht so hochwertig wie die natürlich gewachsenen Quantenpunkte“, veranschaulicht Andreas Wieck. Sie strahlten Licht nicht so perfekt aus.
Daher arbeitete das Team mit den natürlich gewachsenen Quantenpunkten weiter. Für die Arbeiten wurde der Bierdeckel-große Wafer in Millimeter-kleine Rechtecke zerschnitten. Den ganzen Wafer konnten sie nicht auf einmal untersuchen, weil die Vakuumkammer der Apparatur an der RUB schlicht nicht groß genug dafür war. Die Forscher beobachteten aber, dass manche Wafer-Rechtecke viele Quantenpunkte enthielten, andere wenige. „Eine Systematik dahinter fiel uns zunächst nicht auf“, erinnert sich Andreas Wieck – weil die Forscher nie das ganze Bild sahen.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, kooperierte das Bochumer Team mit den Kollegen der TUM, die schon früh ein Messgerät mit größerer Probenkammer zur Verfügung hatten. Bei diesen Analysen stellte die Gruppe fest, dass es eine seltsame Verteilung von Bereichen mit hohen und niedrigen Quantenpunkt-Dichten auf dem Wafer gab. „Die Strukturen erinnerten stark an ein Moiré-Muster, das häufig bei digitalen Abbildungen auftritt. Schnell hatte ich die Idee, dass es sich eigentlich um ein konzentrisches Muster, also Ringe handeln müsse, und dass diese in Korrelation zu unserem Kristallwachstum zu sehen sind“, berichtet Arne Ludwig. Messungen mit höherer Auflösung zeigten in der Tat, dass die Dichte der Quantenpunkte konzentrisch verteilt war. Im Folgenden bestätigte sich, dass diese Anordnung durch den Herstellungsprozess bedingt war.
Der Wafer wird zunächst mit zusätzlichen Atomlagen beschichtet. Durch die Geometrie der Beschichtungsanlage entstehen dabei ringförmige Strukturen, die eine komplette Atomlage besitzen, wo also an keiner Stelle der Schicht ein Atom fehlt. Zwischen den Ringen bilden sich ähnlich breite Bereiche, die nicht mit einer kompletten Atomlage versehen sind und somit eine rauere Oberfläche haben, weil einzelne Atome fehlen. Das hat Konsequenzen für das Wachstum der Quantenpunkte. „Um im Bild zu bleiben: Die Pilze wachsen lieber auf dem lockeren Waldboden, also an den rauen Stellen, als auf einer betonierten Fläche“, sagt Andreas Wieck.
Die Forscher optimierten den Beschichtungsprozess so, dass die rauen Bereiche in regelmäßigen Abständen – von unter einem Millimeter – auf dem Wafer entstanden und dass sich die Ringe kreuzten. So ergab sich ein beinahe schachbrettartiges Muster mit Quantenpunkten hoher Qualität, wie die Kollegen aus Basel und Kopenhagen zeigten.
U. Bochum / DE











