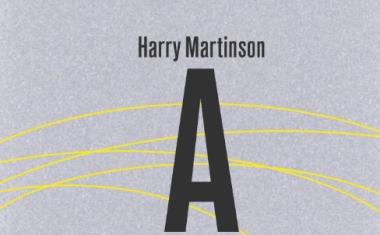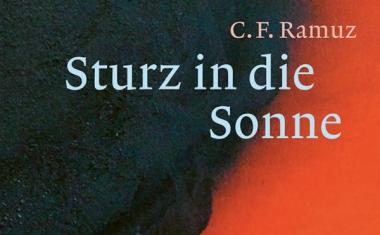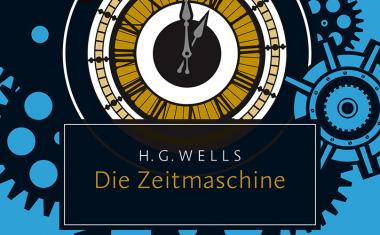Zeit der Oligarchen
Aldous Huxley, Zeit der Oligarchen. Über Wissenschaft, Freiheit und Frieden, Hanser, München 2025, 96 s., geb., 14 Euro, ISBN 9783446287235
Aldous Huxley
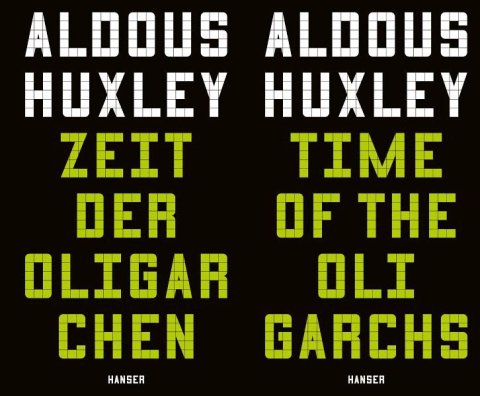
Immer wieder gibt es Wiederentdeckungen von in Vergessenheit geratenen Texte, die lange nach ihrem Erscheinen unerwartet aktuell erscheinen. Beispiele sind E. M. Forsters Kurzgeschichte Die Maschine steht still (The Machine stops, 1909), welche die Isolation des Internetzeitalters vorherzusehen scheint, oder Oskar Panizzas Erzählung Die Menschenfabrik (1890), aus der man Bezüge zur Künstlichen Intelligenz herauslesen könnte.
In diese Reihe scheint der zweiteilige längere Essay von Aldous Huxley zu passen, der fast achtzig Jahre nach seiner ersten (und bislang einzigen) deutschsprachigen Ausgabe im Jahr 1947 nun neuübersetzt sowie auch im englischen Original bei Hanser erscheint. Der Originaltitel Science, Liberty and Peace (1946) ist jetzt allerdings Zeit der Oligarchen gewichen, findet sich aber zumindest im Untertitel wieder.
Im Gegensatz zu den erstgenannten Büchern hat man es deutlich weniger mit einer Zukunftsvision zu tun. Anders als in seinen fiktiven Werken, wie den Dystopien Brave New World (1932) oder Ape and Essence (1948) bzw. der Utopie Island (1962), bietet Huxley in seinem Essay von 1946 primär eine nüchterne Analyse der damaligen Gegenwart. Damit zielt er natürlich auf eine bessere Zukunft. Der neue Titel macht die neue Buchausgabe zu einer Mogelpackung, denn wer in Huxleys „boy gangster“ (so auch in der deutschen Ausgabe) heutige Megareiche und Despoten zu erkennen meint, liegt vielleicht nicht falsch, aber es lässt sich mit Huxley nichts über Trump, Musk und Co. lernen.
Huxley prangert stattdessen wirtschaftliche Zentralisierung, erstarkenden Nationalismus und Missbrauch der Wissenschaft an und sucht nach Lösungsansätzen. Die sieht er im Falle der Wissenschaft im passiven Widerstand à la Ghandi, einer Art Weltagentur zur Überwachung der Forschung und in einem verstärkten Engagement der Wissenschaftler:innen für dezentrale Lösungen, insbesondere wenn es um Nahrungs- und Energieversorgung geht.
In einer zeitgenössischen Kritik bescheinigt der Rezensent Aldous Huxley, dass er besser in der Diagnose als bei den Vorschlägen zur Therapie sei. Das gilt auch heute noch. Allerdings sind Huxleys Analysen immer noch eine erhellende Lektüre und – bedauerlicherweise – gut auf heutige Zustände anwendbar.
Ein weiterer Kritikpunkt war, dass dem schmalen Bändchen explizite Hinweise auf Werke fehlen, auf die Huxley Bezug nimmt oder von denen er inspiriert wurde. Das gilt leider auch immer noch. Hier hätte diese Neuedition mit einer kundigen Kommentierung Abhilfe leisten können, aber darin finden sich als Zugabe nur magere biografische Zeilen zu Huxley sowie zum Übersetzer Jürgen Neubauer. Erläuternde Anmerkungen und ein erhellendes Nachwort wären nach so langer Zeit mehr als wünschenswert gewesen. Wer kennt schon Wilfred Wellock oder Ralph Borsodi (S. 64) und weiß, dass es sich bei „Free America“ um eine Zeitschrift handelt?
Werkgetreu wird auch ein Fehler von Huxley übernommen. So bezieht er sich auf Science in the Modern World von Thorstein Veblen (S. 75). Mir war dieser Autor unbekannt und erst nach längere Suche stieß ich darauf, dass Huxley sehr wahrscheinlich Veblens Essay The Place of Science in Modern Civilization von 1906 gemeint haben dürfte, der sich auch in der gleichnamigen Essay-Anthologie von 1919 findet.
Kurzum: Huxleys Essay ist trotz seiner Beschränkungen immer noch lesenswert, denn man wird immer wieder Bezüge zu heutigen Misständen finden. Der Text verdient aber mehr editorischen Aufwand. Mit weiteren passenden Texten Huxleys hätte er auch eher die kritische Masse für ein gebundenes Buch gehabt.
Alexander Pawlak