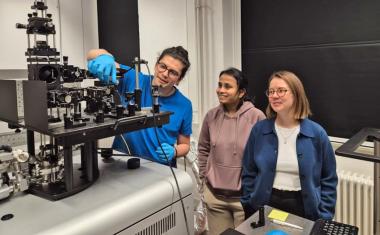Erstmals vermessen und kartiert: blauer Phosphor
Elektronische Bandstruktur bestätigt exotische Phosphor-Modifikation.
Das Element Phosphor tritt in vielerlei Gestalt auf und wechselt mit jeder neuen Modifikation auch seine Eigenschaften. Bisher bekannt waren roter, violetter, weißer und schwarzer Phosphor. Während einige Phosphorverbindungen lebenswichtig sind, ist weißer Phosphor giftig und brandgefährlich. Schwarzer Phosphor ist dagegen besonders stabil. Doch 2014 fanden Forscher der Michigan State University in den USA heraus, dass auch blauer Phosphor stabil sein sollte. In dieser Modifikation vernetzen sich die Phosphor-
Abb.: Die STM-Aufnahme zeigt blauen Phosphor auf einem Gold-
Bereits 2016 gelang es, blauen Phosphor durch Aufdampfen auf einer Goldoberfläche abzuscheiden. Doch erst jetzt gibt es die Gewissheit, dass es sich dabei tatsächlich um blauen Phosphor handelt. Dafür hat ein Team vom HZB um Evangelos Golias an BESSY II erstmals die elektronische Bandstruktur solcher Proben vermessen. Sie konnten die Energieverteilung der äußeren gebundenen Elektronen im Valenzband mit der Methode der winkelaufgelösten Photoemissionsspektroskopie abtasten und damit eine untere Grenze für den Wert der Bandlücke von blauem Phosphor angeben.
Dabei fanden sie heraus, dass die P-Atome sich nicht ganz unabhängig vom Gold-
„Bisher hat man vor allem schwarzem Phosphor benutzt, um davon einzelne Atomlagen abzutragen“, erklärt Oliver Rader vom HZB. „Diese einzelnen Atomlagen weisen ebenfalls eine große Bandlücke auf, besitzen aber nicht die Bienenwabenstruktur des blauen Phosphors und können vor allem nicht direkt auf einem Substrat hergestellt werden. Unsere Ergebnisse offenbaren nicht nur die Materialeigenschaften dieser neuartigen zweidimensionalen Modifikation des Phosphors, sondern zeigen auch, wie das Substrat das Verhalten der Elektronen im blauen Phosphor beeinflusst. Und das ist ein wichtiger Faktor für jegliche optoelektronische Anwendung.“
HZB / RK