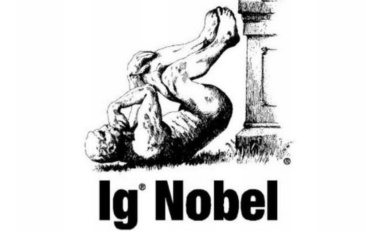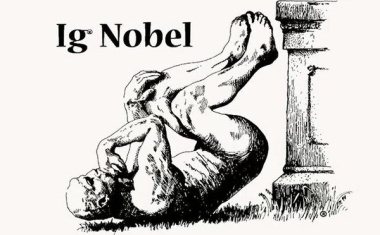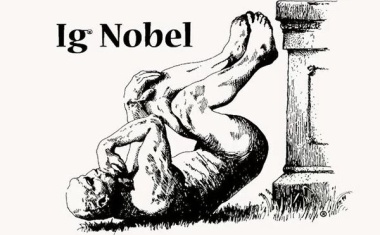Phasenübergänge in Pastasaucen
Der Ig Nobel-Preis in der Kategorie Physik geht an ein Forschungsteam aus Italien, Spanien, Deutschland und Österreich für die Anleitung zu perfekter „Cacio e Pepe“-Pasta.
Kerstin Sonnabend
Gut zwei Wochen bevor verkündet wird, wer die begehrten Nobelpreise erhält, würdigt eine satirische Auszeichnung wissenschaftliche Leistungen, die „Menschen zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen“. Welche Kategorien der Ig Nobel-Preis in einem Jahr auszeichnet, ist nicht streng festgelegt; auch die Zuordnung zu den Disziplinen lässt manchmal staunen. In der Kategorie Physik gewann in diesem Jahr eine Arbeit, die sich mit Phasenübergängen in einem ganz besonderen Gemisch beschäftigt: der so einfachen wie köstlichen Pastasauce „Cacio e Pepe“. Kaum verwunderlich, dass alle Mitglieder des ausgezeichneten Forschungsteams aus Italien stammen, obgleich sie mittlerweile auch an Institutionen in Spanien, Deutschland und Österreich arbeiten. Die Arbeit zum perfekten Soßenrezept entstand, als alle am Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden forschten.

Rezept für „Cacio e Pepe“
240 g Pasta in Salzwasser kochen. 4 g Stärke in 40 ml Wasser auflösen, sodass ein Gel entsteht. 160 g Pecorino Romano würfeln und mit dem Gel fein pürieren. Die gekochten Nudeln mit grob gemahlenem Pfeffer in einer heißen Pfanne mischen und die Käsemasse unterrühren. Eventuell etwas Nudelwasser zugeben. Mit Pfeffer und Salz würzen.
Für „Cacio e Pepe“ gilt es, Pecorino-Käse, etwas Nudelwasser, Pfeffer und die Nudeln zu vermischen. Was einfach klingt, führt oft nicht zur gewünschten cremigen Emulsion, sondern nur zu Käseklümpchen. Das Forschungsteam wollte nicht nur die Ursache dafür finden, sondern mit diesem Wissen auch ein Rezept mit Geling-Garantie entwickeln. Mit einer Experimentreihe erkundeten die Forschenden den Parameterraum aus Kochtemperatur und Stärkegehalt der Mischung. Schnell war klar, dass die im Nudelwasser gelöste Stärke selten ausreicht, um die Sauce zu emulgieren und zu stabilisieren, wenn die Proteine im Käse oberhalb von 65 °C denaturieren.
Nun galt es herauszufinden, wie viel Stärke zu welchem Zeitpunkt hinzuzugeben ist. Zahlreiche Versuche später stand fest, dass etwa zwei bis drei Prozent der Käsemasse ausreichen. Das Stärkepulver wird in Wasser gelöst und bei geringer Temperatur unter den Käse gerührt. Wenn die Temperatur steigt, verbindet sich die Stärke mit den Proteinen und verhindert das Klumpen. Die gewünschte Cremigkeit ergibt sich durch die Zugabe des Nudelwassers. Neben der Geling-Garantie sorgt die zusätzliche Stärke auch dafür, dass sich das Gericht mehrmals auf 80 bis 90 °C erwärmen lässt, ohne dass die Sauce in ihre Bestandteile zerfällt.
Wie gut „Cacio e Pepe“ mit dem Rezept gelingt, stellten sieben der acht Beteiligten bei der Preisverleihung in der Boston University unter Beweis und servierten den anwesenden Nobelpreisträger:innen eine Portion als Geschmacksprobe. Was mit der Stärke und den Proteinen beim Kochen passiert, illustrierten sie mit einer spaßigen Darstellung, während einer von ihnen mit ernster Miene die Fakten dazu erklärte – also alles ganz im Sinne des Mottos „Research that makes people LAUGH … then THINK“ des Ig Nobel-Preises.
Doch die derzeit weltweit herrschenden Krisen und Konflikte gingen auch an der Verleihung nicht spurlos vorbei. Noch nie nahmen weniger der Ausgezeichneten persönlich ihren Preis bei der Zeremonie entgegen – und das aus sehr unterschiedlichen Gründen. So blieben zwei Forscher der israelischen Ben-Gurion-Universität im Negev der Verleihung fern, um Störungen durch Protestaktionen zu vermeiden: Die Universität ist unter anderem umstritten, weil sie einen Dozenten suspendierte, der Israels Regierung und Militär kritisierte. Forschende aus Deutschland wollten nicht riskieren, bei der Einreise in Gewahrsam genommen zu werden. Einem indischen Team reichte die Zeit nicht aus, weil Visaanträge mittlerweile mehr als ein halbes Jahr Bearbeitungszeit haben.
Daher hat das Organisationsteam um Marc Abrahams schon im Vorfeld drei weitere Veranstaltungen in London am 31. Oktober, in Berlin im November und in Tokio im Januar organisiert. Dabei treffen sich die Preisträgerinnen und Preisträger der verschiedenen Kategorien und erklären sich gegenseitig ihre Forschung. Die Hoffnung ist, dass so alle die Möglichkeit haben, zumindest einmal vor Ort dabei zu sein.