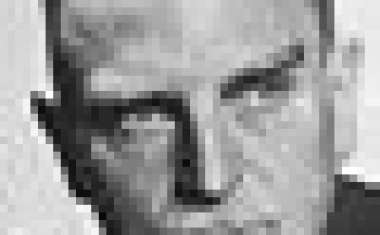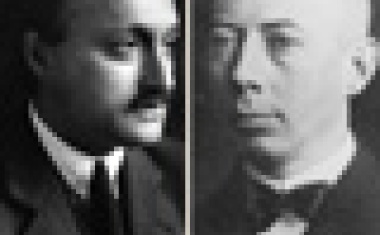Ein Hertz für Ost und West
Vor 50 Jahren starb der Physik-Nobelpreisträger Gustav Hertz, der mit dem Franck-Hertz-Experiment zu den Pionieren der Quantenphysik gehört.
Anne Hardy
Gustav Hertz erhielt 1926 gemeinsam mit James Franck den Nobelpreis für den Franck-Hertz-Versuch, der zentrale Grundlagen der Quantenphysik bestätigte. Nach Forschungsarbeiten in Industrie und Wissenschaft, insbesondere zur Isotopentrennung, wurde Hertz für den Bau einer Atombombe in der der Sowjetunion zwangsverpflichtet. Ab 1954 lehrte er in Leipzig und galt als bedeutende Integrationsfigur der Physik in Ost und West.

Gustav Hertz wurde am 22. Juli 1887 in Hamburg geboren. Der ältere Bruder seines Vaters war Heinrich Hertz, der Entdecker der elektromagnetischen Wellen. Gustav Hertz Senior arbeitete der Familientradition folgend als Rechtsanwalt, interessierte sich aber für Naturwissenschaften und gab dies an seinen Sohn weiter. So studierte Gustav junior nach dem Abitur (1906) Mathematik und Physik, zunächst in Göttingen, dann bei Arnold Sommerfeld in München und ab 1908 an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Er promovierte 1911 bei Heinrich Rubens und wurde Assistent am Physikalischen Institut. Bald gehörte er zu dem Freundeskreis von Otto Hahn, Lise Meitner und James Franck.
Der fünf Jahre ältere Privatdozent Franck, ebenfalls Hanseate, gewann ihn 1912 für Experimente, die später als der „Franck-Hertz-Versuch“ bekannt wurden. Ursprünglich gingen die beiden Freunde davon aus, dass sie in ihrer Kathodenstrahlröhre die Ionisation des Füllgases beobachteten. Diesen Prozess hatte der Brite John Townsend 1901 beschrieben. Allerdings traf Townsends Stoßionisationstheorie nicht auf Edelgase zu. Die gemessenen ,,Ionisierungszahlen” schienen nicht zum Verhältnis der Ionisierungsarbeit zur freien Weglänge der stoßenden Elektronen zu passen. Franck und Hertz wollten dies verstehen, indem sie die Größen einzeln untersuchten. Durch neue, weniger störanfällige Apparaturen, die möglichst Kitt- und Fettstellen vermieden und Quecksilberdampf ausfroren, hofften sie zuverlässigere Werte zu erhalten.
1913 stellten sie fest, dass Zusammenstöße von Elektronen mit Atomen unterhalb einer bestimmten Energiegrenze vollkommen elastisch verlaufen. Erst nach Überschreiten dieser Schwellenenergie geben die Elektronen beim Stoß einen Teil ihrer Energie ab, was zur Aussendung von Licht führt. Überraschenderweise konnte die Energie nur in ganzzahligen Vielfachen der Schwellenenergie übertragen werden. Franck und Hertz sahen darin zunächst nur eine Bestätigung von Plancks Quantenhypothese; erst 1915 machte Niels Bohr sie darauf aufmerksam, dass ihr Experiment zugleich sein Atommodell stützte.
Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, mussten die beiden Physiker ihre Arbeit unterbrechen. Zusammen mit Otto Hahn wurden sie Fritz Haber zugeteilt, der an der Front den Einsatz von Giftgas koordinierte. 1915 erlitt Gustav Hertz eine schwere Gasvergiftung und verbrachte mehrere Wochen im Lazarett. Er musste nicht an die Front zurück. So nutzte er die nächsten zwei Jahre zur Habilitation. Nach dem Krieg publizierte er mit Franck die korrekte Interpretation der gemeinsamen Versuche, für die sie 1926 rückwirkend für 1925 den Physik-Nobelpreis erhielten.
1919 heiratete Hertz Ellen Dihlmann; seine beiden Söhne wurden ebenfalls Physiker. 1920 zog das junge Paar nach Eindhoven, wo Gustav Hertz eine Anstellung bei der Glühlampenfabrik Philips erhalten hatte. Hier forschte er weiter zur Physik der Gasentladungen. Außerdem begann er, sich mit der Trennung von Edelgasgemischen für die Produktion von Glühlampen zu beschäftigen. 1925 setzte er seine akademische Laufbahn als Professor für Physik an die Universität Halle fort. Zwei Jahre nachdem er den Nobelpreis erhalten hatte, folgte 1928 der Ruf an die Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg, wo Hertz das neue Physikalische Institut leitete. Es waren erfolgreiche Jahre. So gelang ihm die Trennung von Neon-Isotopen und 1934 die Reindarstellung von schwerem Wasserstoff.
Als ihm 1935 die Lehrerlaubnis aufgrund der nationalsozialistischen Gesetzgebung entzogen wurde – sein Großvater väterlicherseits war getaufter Jude –, legte Gustav Hertz seine Professur aus Protest nieder und wechselte wieder in die Industrie, dieses Mal als Leiter des Forschungslabors II bei Siemens und Halske. Neben der Konstruktion von Anlagen für leichte Isotope, forschte er auch zur Halbleitertechnik, zu Ultraschall und zum Photoeffekt. Die Untersuchungen von Elektronen und Ionen, die aus Metallen emittiert wurden, inspirierten seinen Mitarbeiter Erwin W. Müller 1936 zur Entwicklung des Feldelektronenmikroskops.
James Franck hatte schon 1933 seine Professur in Göttingen niedergelegt und war in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Wie Dieter Hoffmann berichtet, nahm Hertz zu ihm Kontakt auf, als er im März 1938 zu Bohr nach Kopenhagen reiste. Er schrieb: ,,Lieber Franck, ich bin zu einem kurzen Besuch in Kopenhagen und will die Gelegenheit benutzen, Dir einmal ohne Zensur zu schreiben. […] Vielleicht komme ich Ende des Jahres auch kurz nach Amerika . . . um Kernphysik zu sehen, nicht etwa, um für mich draußen eine Stellung zu suchen. Ich glaube, daß ich in meiner Lage in Deutschland bleiben soll, solange es geht."
Hertz traf 1941 ein weiterer Schicksalsschlag: Mitten im Krieg starb seine Frau während einer Operation. Zwei Jahre später heiratete er erneut. 1945 lag das Forschungslabor II der Siemenswerke Berlin in Trümmern: Hertz hatte sich vor dem Bombenangriff der Alliierten nur knapp in den Luftschutzkeller retten können. Als die Rote Armee in die Hauptstadt einmarschierte, folgte er der „Einladung“, in der Sowjetunion ein Forschungslabor zur Uran-Anreicherung aufzubauen.
Wie Hertz später seinem Neffen Hardwin Jungclaussen erklärte, sei er nicht in die USA gegangen, weil er erwartete, „dass er als Physiker für die Russen mehr Wert sei als für die Amerikaner. Darum erwartete er in der Sowjetunion ein wissenschaftlich befriedigenderes und privat angenehmeres Leben als in den USA.“ Sein Onkel sei ein bescheidener Mensch gewesen, der keine besonderen Ansprüche stellte, solange er an interessanten Problemen arbeiten konnte.
Hertz folgten 17 andere deutsche Spezialisten für Isotopentrennung, die er ausgewählt hatte, unter anderem Werner Hartmann, der spätere Begründer der Mikroelektronik in der DDR. Hertz baute ein Forschungsinstitut zur Trennung von Uran-Isotopen bei Suchumi am Schwarzen Meer auf. Es hatte den Codenamen Institut G. Nicht weit davon entfernt befand sich das Forschungsinstitut von Manfred von Ardenne (Institut A), in dem dieser an der elektromagnetischen Trennung von Uranisotopen arbeitete.
Für die Wissenschaftler und ihre Familien war der Umzug in die Sowjetunion eine Chance, den Nachkriegswirren in Deutschland zu entfliehen. Sie erhielten zahlreiche Vergünstigungen; so wurde für Gustav Hertz eine Villa gebaut. Aber sie mussten auch erhebliche Einschränkungen hinnehmen. So durften die Physiker anfangs keinen Kontakt mit der lokalen Bevölkerung pflegen oder das Gelände ohne Bewachung verlassen. Hertz hatte jedoch den Mut, sich bei dem gefürchteten Marschall Berija, dem Leiter des russischen Atombombenprojekts, zu beschweren. Daraufhin wurden die Vorschriften gelockert. Für seine Verdienste erhielt er 1951 den Stalin-Preis der UdSSR. Auch die DPG vergaß ihn nicht in seinem abgelegenen Labor und zeichnete ihn in demselben Jahr zusammen mit James Franck mit der Max-Planck-Medaille aus.
Als Gustav Hertz 1954 in die DDR zurückkehrte, war er darauf bedacht, die am Schwarzen Meer zurückgebliebenen Kollegen nicht zu gefährden. Max Born, der ihn im Frühjahr 1955 an der Universität Leipzig traf, hatte Gelegenheit, mit ihm ein paar vertrauliche Worte zu wechseln. Born berichtete in einem Brief an James Franck: „Er [Hertz] sagte sofort: ,Was ich öffentlich sage, hat nichts zu tun mit dem, was ich denke. Z.B. ich sage, daß ich nicht nach dem Westen gehe, weil ich die Zustände dort verabscheue. In Wahrheit gehe ich nicht, weil ich dadurch mich in Verdacht bringen und die Rückkehr vieler, noch in Rußland zurückgehaltener Physiker gefährden würde.”
In der DDR leitete Gustav Hertz das physikalische Institut der Universität Leipzig. Für Forschung hatte er nun wenig Zeit, aber er gab sein Wissen zur Kernphysik in der Lehre und einem dreibändigen Lehrbuch weiter. Direkt nach seiner Rückkehr wurde er Vorsitzender des Rats für die friedliche Anwendung der Kernenergie. Er solidarisierte sich 1957 mit seinen westdeutschen Kollegen, die mit dem Göttinger Appell gegen die geplante atomare Bewaffnung der Bundeswehr protestierten. Ebenso unterzeichnete er die Mainauer Erklärung der Nobelpreisträger, die zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aufrief. Hertz war der einzige in der DDR lebende Nobelpreisträger.
In der Physikalischen Gesellschaft der DDR war Gustav Hertz ab 1954 Mitglied des Vorstands und fungierte zunehmend als dessen Sprecher, obwohl er nie offizieller Vorsitzende war. Er war „für viele Physiker in Ost und West eine Integrationsfigur“, so der Wissenschaftshistoriker Dieter Hoffmann.
1961, im Alter von 74 Jahren, wurde Hertz emeritiert und zog nach Berlin-Köpenick. Den Sommer verbrachte er auf der Ostsee-Insel Hiddensee, wo er ein Sommerhaus hatte und bis ins hohe Alter segelte. Er starb am 30. Oktober 1975 im Alter von 88 Jahren in Berlin. Nach ihm ist der Gustav-Hertz-Preis für junge Physiker:innen der DPG benannt.
Quellen und weitere Inormationen
- Physik-Nobelpreis 2025: Gustav Hertz
- Vortrag von Gustav Hertz (1968): Erinnerungen an James Franck und die Elektronen-Streu-Experimente (Lindau Mediatheque)
- C. Kleint, Gustav Hertz — zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages, Physikalische Blätter 43, 255 (1987) PDF
- F. Wolf, Wozu der Franck-Hertz-Versuch wirklich unternommen wurde, Physikalische Blätter 30, 74 (1974) PDF
- D. Hoffmann, Die Physikalische Gesellschaft (in) der DDR, Physikalische Blätter 51, F-157 (1995) PDF
- Horst Kant, Gustav Hertz, in: Wer war wer in der DDR?, 5. Ausgabe. Band 1., Ch. Links, Berlin 2010
- Der Franck-Hertz-Versuch. Erklärung für Lehramtsstudierende mit Erklärvideo (Universität Göttingen)
- Wikipedia-Artikel zu Werner Hartmann, Abschnitt „Das UdSSR-Jahrzehnt“
- Hardwin Jungclaussen, Frei in drei Diktaturen. Wie ich mein Leben erlebte und wie ich mein Glück fand. Trafo Verlag, Berlin 2015
- Physik Journal Dossier: Physik in der DDR und Wiedervereinigung
AP