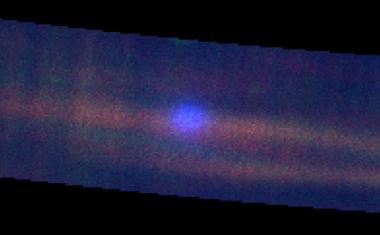Know-how für bessere Batterien
Auf der Suche nach alltagstauglichen Lösungen für Festkörperzellen.
Batterien sind eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende. Ohne leistungsstarke Energiespeicher kann der Übergang von fossilen Brennstoffen zu regenerativen Energien nicht gelingen. Leistungsfähiger, langlebiger und leichter sollen sie sein. Im Labor funktionieren die Batterien der nächsten Generation bereits. Doch Festkörperzellen in einem größeren Maßstab zu bauen, sodass sie verlässlich Autos oder auch Flugzeuge antreiben, ist eine ganz andere Herausforderung. An alltagstauglichen Lösungen arbeiten Forscher in der U Bremen Research Alliance mit Hochdruck.

Julian Schwenzel war seiner Zeit voraus: Als der Physiker vor zwanzig Jahren über Batterien promovierte, interessierte sich kaum jemand für die elektrochemische Speicherung von Energie. Schwenzel war zunächst im Anlagenbau tätig, für Batteriefachleute gab es wenige Jobs. Heute ist er Abteilungsleiter für elektrische Energiespeicher am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung und leitet ein Team mit 22 Mitarbeitern. „Die Mannschaft“, sagt er, „wächst kontinuierlich. Wir brauchen ständig mehr Laborfläche, mehr Platz.“
Fabio La Mantia hat Im Fachgebiet „Energiespeicher- und Energiewandlersysteme“ des Fachbereichs Produktionstechnik der Universität Bremen eine Brückenprofessur inne, die 2015 in Kooperation mit dem Fraunhofer-IFAM ins Leben gerufen worden ist. Beide Institutionen, die Universität und das Fraunhofer-IFAM, sind Mitgliedseinrichtungen der U Bremen Research Alliance. Während La Mantia Grundlagenforschung betreibt, stehen bei Schwenzel die Anwendungen im Vordergrund. Beide arbeiten eng zusammen. „Wir teilen uns die Labore, ergänzen uns super in unseren Kompetenzen, profitieren gegenseitig voneinander“, so Schwenzel.
Wie können die Energie- und Leistungsdichte erhöht, die Ladefähigkeit und Lebensdauer verbessert, die Sicherheit und die Kreislauffähigkeit vergrößert werden – das sind einige der Fragen, an denen die Arbeitsgruppen forschen. „Wir arbeiten in zwei Richtungen“, erzählt Schwenzel, „und zwar an der intelligenten Überwachung der Batterien mithilfe von Algorithmen und an neuen Materialien.“
Die etablierten Lithium-Ionen-Batterien, wie sie in Autos, Laptops und Handys seit Langem verbaut werden, nutzen flüssige Elektrolyten als Leiter für elektrischen Strom. Ihr Nachteil: Sie sind brennbar, ihr Potenzial ist weitgehend ausgeschöpft. „Fest statt flüssig“, lautet deshalb die Devise. Erprobt werden Festkörper als Leiter, wie Sulfide oder Polymere. Sie sind nicht entflammbar, verfügen über eine hohe Energiedichte und lassen sich zudem besser verarbeiten.
„Die Materialklassen haben unterschiedliche Eigenschaften“, erläutert Schwenzel. Polymere etwa lassen sich gut bearbeiten, Sulfide schneller laden und entladen. Das ist wichtig für die Automobilindustrie, die zu den Kunden des Fraunhofer-IFAM zählt, allerdings sind Sulfide feuchtigkeitsempfindlich. Im Labor haben die Forscher die unterschiedlichsten Material- Rezepturen erprobt. Im Kleinen arbeiten die Festkörperbatterien perfekt. Sie im Großmaßstab herzustellen, sei jedoch eine ganz andere Welt, so Schwenzel: „Da geht es um Zigtausende von Beschichtungen für mehrlagige verschaltete Einzelzellen zu einem Gesamtbatteriesystem. Das kann im Moment noch niemand leisten.“
Um elektrochemische Systeme bauen zu können, ist ein enormes Know-how nötig. „Die Prozesskette – vom Pulver bis zur Zelle – ist komplex. Die Elektrochemie ist schwierig zu kontrollieren, das darf man nicht unterschätzen“, betont Schwenzel. Batterien haben ein Eigenleben: Sie altern, jede ist anders und kleine Verunreinigungen in der Produktion können einen großen Einfluss auf die Lebensdauer haben.
Die Analyse der Batterie ist eine der Expertisen von La Mantia. Seine Arbeitsgruppe hat eine Methode entwickelt, die Schwachstellen einer Batterie im Betrieb identifiziert und ihre Lebensdauer prognostiziert – unabhängig von der Art des Leiters. „Im Grunde“, sagt er, „geht es darum, eine Batterie besser zu verstehen und sie zu optimieren.“ Das geschieht etwa durch eine permanente Erfassung der Daten. „Wir sprechen von dynamischer Frequenzanalyse“, so La Mantia.
Der Forscher hat sich auch dem Lithium-Problem gewidmet. Das Metall ist eines der wichtigsten Rohstoffe für Batterien. Die Nachfrage nach Lithium insbesondere durch die Autoindustrie wird in den kommenden Jahren regelrecht durch die Decke gehen, es wird knapp und gefördert wird es nur in wenigen Ländern unter oft schwierigen Bedingungen. „Die Frage ist: Können wir Technologien finden, die nicht auf Lithium basieren, die nachhaltiger und kostengünstiger sind?“, so La Mantia. Geforscht wird etwa an Akkus auf Zinkbasis, die insbesondere für stationäre Anwendungen wie die Speicherung von Solarenergie interessant sind – oder auch an Metall-Luft-Batterien.
Für das Lithium-Problem gibt es noch einen weiteren Ansatzpunkt: die Gewinnung des Rohstoffs in Deutschland. Lithium kommt in der Natur in Form von Salzen vor. La Mantia und seine Arbeitsgruppe haben einen Weg gefunden, wie das Metall aus geothermischen Quellen und aus Abwasser extrahiert werden kann. Ähnlich wie bei den Feststoffbatterien funktioniert das Verfahren im Labor bereits, auch hier ist das Upscaling die Herausforderung. „Wir sind darüber bereits im Gespräch mit Unternehmen“, erzählt er. „Das Recycling ist für uns ein ganz großes Thema“, ergänzt Schwenzel. So arbeiten die Forscher an verschiedenen Verfahren, wie Batterien zerlegt und Rohstoffe wiedergewonnen werden können.
Der Batterie-Sektor boomt. Weltweit forschen Wissenschaftler an einer neuen Generation von Batterien. Doch Schwenzel fürchtet Konkurrenz nicht: „Unser Vorteil ist, dass wir unsere Expertise aus anderen Anwendungsfeldern auf die Batterieforschung übertragen können.“ Eine interessante Anwendung sei etwa das Drucken von Batterien, die dann ganz andere Formen annehmen können, jenseits der gewohnten rechteckigen Kästen. Bis derartige Technologien im Alltag ankommen, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Im Fall der Feststoffbatterie rechnet Schwenzel mit fünf Jahren.
U Bremen Research Alliance / RK
Weitere Infos