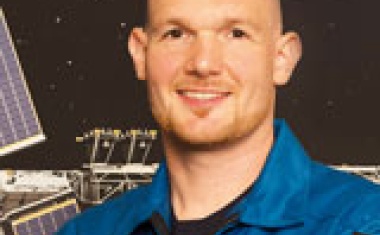Nachhaltiger Handschlag im All
Das Apollo-Sojus-Test-Projekt vor 50 Jahren war nicht nur ein Zeichen der Völkerverständigung, sondern diente auch der Wissenschaft.
Alexander Pawlak
Abgesang der Apollo-Ära, erstes bilaterales Raumfahrtunternehmen, Zeichen amerikanisch-sowjetischer Entspannung und Vorbote einer späteren internationalen Zusammenarbeit im All, das Apollo-Sojus-Test-Projekt – so seine amerikanische Bezeichnung – war kurz, aber symbolträchtig.
Vereinbart hatten es Leonid Breschnew und Richard Nixon bereits 1972, noch bevor mit Apollo 17 das letzte Mal Menschen den Mond betraten. Neben der politischen Entspannung zwischen den beiden Großmächten ging es auch darum, Voraussetzungen für Rettungsmissionen im All zu erproben. Dafür musste ein Kopplungsmechanismus zwischen den amerikanischen und sowjetischen Raumfahrzeugen entwickelt werden, was einen technologischen und personellen Austausch erforderte, der bis dahin zwischen den ehemaligen Rivalen unmöglich gewesen war.
Am 15. Juli 1975 startete ein Apollo-Raumschiff mit einer dreiköpfigen Besatzung und dockte zwei Tage später, am 17. Juli, an ein Sojus-Raumschiff mit zwei Besatzungsmitgliedern an.
Die NASA schickte mit Thomas Stafford einen erfahrenen Astronauten ins All, der unter anderem mit Apollo 10 an der Generalprobe für die Mondlandung teilgenommen hatte. Deke Slayton war mit 51 der bis dahin älteste Astronaut. Er gehörte zu den „Mercury Seven“, der ersten Astronauten-Generation, und war wegen Herzrhythmus-Problemen zum Chef des Astronauten-Korps ernannt worden, ohne selbst ins All fliegen zu können. Da sich seine gesundheitlichen Probleme wieder legten, brachte er sich für das ASTP kurzerhand selbst ins Spiel. Dritter Mann war Vance D. Brand, davor zuletzt Reservekommandant für Skylab.
An Bord der russischen Sojus waren Kommandant Alexei Leonow, der mit Woschod 2 im März 1965 den ersten Außenbordeinsatz im Weltraum unternommen hatte, und der Flugingenieur Waleri Kubassow, der mit Sojus 6 im Oktober 1969 im All gewesen war.




Die USA starteten ein Apollo-Kommando- und Servicemodul auf einer Saturn IB-Rakete. Das Apollo-Raumschiff war zwar fast identisch mit dem Typ, der den Mond umkreiste und später die Astronauten zum Skylab brachte, wurde jedoch modifiziert, um Experimente, zusätzliche Treibstofftanks, Steuerungen und Ausrüstungen für das Andockmodul zu ermöglichen. Die Sojus war seit ihrer Einführung im Jahr 1967 das wichtigste sowjetische Raumfahrzeug für den bemannten Flug. Das Andockmodul wurde von der NASA entworfen und gebaut, um als Luftschleuse und Transferkorridor zwischen den beiden Raumfahrzeugen zu dienen.
Während der insgesamt neuntägigen Mission waren die beiden Besatzungen rund 44 Stunden zusammen und nutzten diese Zeit nicht nur für symbolische Aktivitäten und technische Tests, sondern auch für gemeinsame wissenschaftliche Experimente.
Dazu gehörte die Analyse der Zusammensetzung und Struktur der oberen Erdatmosphäre sowie der Wechselwirkungen mit Sonnenstrahlung. Die Spektrometer an Bord beider Raumfahrzeuge maßen dafür die Absorption von ultraviolettem Licht durch die Erdatmosphäre. Diese Daten halfen, Modelle der oberen Atmosphäre zu verbessern und den Einflusses von Sonnenaktivität auf die Ionosphäre besser zu verstehen. Dies war insbesondere relevant für Funkkommunikation und Satellitenbetrieb.
Darüber hinaus untersuchten die Astronauten und Kosmonauten das Verhalten von Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit, etwa die Kapillareffekte, Oberflächenspannung und das Verhalten von Flüssigkeitstropfen bei Bewegung. Dies war relevant, um die Flüssigkeitssysteme für spätere Raumstationen zu optimieren.
Mit synchronisierten Messungen an Bord von Apollo und Sojus kartierten beide Besatzungen das Erdmagnetfeld aus verschiedenen Umlaufbahnen, was für die Untersuchung der Magnetosphäre der Erde und des Weltraumwetters wichtig war.

Nach Abkopplung der beiden Raumfahrzeuge erzeugte die Apollo-Kapsel eine künstliche Sonnenfinsternis, sichtbar aus der Sojus-Kapsel. Die amerikanischen Astronauten nutzten die verbleibende Zeit im All für ein umfangreiches wissenschaftliches Programm. Dieses umfasste astronomische Untersuchungen im Röntgen-, extremen Ultraviolett- und Gammastrahlenbereich, Erdbeobachtungen, materialwissenschaftliche Experimente und nicht zuletzt biologische und physiologische Studien.
Von den insgesamt 28 Experimenten stammten auch zwei aus Deutschland: Das biophysikalische Experiment Biostack III der Arbeitsgruppe des Biophysikers Horst Bücker von der Universität Frankfurt untersuchte die Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf Pflanzensamen,Tiereier und Bakteriensporen. Das Elektrophoreseexperiment von Kurt Hannig vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München diente dazu, eine biologischen Zellen gebildeten Proben-Substanz unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit zu fraktionieren.
Der Ingenieur Horst W. Köhler, ab 1974 freier Mitarbeiter der Physikalischen Blätter für Raumfahrtthemen aller Art, hatte sogar selbst ein Werkstoffexperiment beim gemeinsamen Apollo-Sojus-Raumfahrtunternehmen angemeldet, das aber wohl nicht berücksichtigt wurde. Von ihm stammt auch die damalige Vorberichterstattung (hier, ab Seite 323) über das Apollo-Sojus-Projekt in der Juli-Ausgabe der Physikalischen Blätter.
Der NASA blieb glücklicherweise ein tragisches Ende der Mission erspart. Kurz nach der Wasserlandung im Pazifik wurden Stafford, Brand und Slayton in der Kommandokapsel giftigen Dämpfen des Treibstoffsystems ausgesetzt, wobei Brand kurzzeitig bewusstlos wurde. Stafford erkannte die Gefahr und öffnete rechtzeitig manuell die Belüftungsklappen.
Leonow und Stafford entwickelten eine enge Freundschaft und besuchten sich auch später immer wieder gegenseitig. Für beide war das Apollo-Sojus-Projekt der letzte Ausflug ins All. Vance D. Brand blieb in den Diensten der NASA und war im Zeitraum von 1982 bis 1990 als Kommandant an drei Space-Shuttle-Missionen beteiligt.
Insgesamt war das amerikanisch-sowjetische Raumfahrtprojekt ein Erfolg und ebnete den Weg für künftige internationale Partnerschaften. Die Hoffnung auf eine baldige weitere Zusammenarbeit der beiden Großmächte im All erfüllte sich allerdings nicht. Sie wurde erst ab 1994 nach Ende der Sowjetunion mit dem Shuttle-MIR-Programm wieder aufgenommen.
Erstaunlich ist, dass die amerikanisch-russische Kooperation bei der Internationalen Raumstation auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs fortgeführt wurde. Mittlerweile ist China der dritte große Player in der unbemannten wie bemannten Raumfahrt. Angesichts des gespannten Verhältnisses zwischen USA und China, wäre vielleicht eine vertrauensbildende Mission in der Tradition von Apollo-Sojus an der Zeit.
Weitere Informationen
- Apollo-Soyuz Test Project (NASA)
- Apollo-Soyuz Test Project: Preliminary Science Report (NASA)
- Apollo-Soyuz, Mission Evaluation Report (NASA)
- Bildergalerie zum Apollo-Soyuz Test Project (NASA)
- Video: NASA Film „The Mission of Apollo-Soyuz – Rendezvous in Space“ (YouTube)
- Video: Oral History: Vance Brand (YouTube)
- Horst W. Köhler, Gemeinsam im Weltraum - Raumfahrtunternehmen Apollo-Sojus, Physikalische Blätter 31, 323 (1975) PDF
- D. Volf, Evolution of the Apollo-Soyuz Test Project, Minerva 59, 399 (2021) [Open Access]
- Raumfahrtliteratur (Rezensionen)
Meist gelesen

Interview mit einem Quant
Vor 125 Jahren begründete Max Planck mit der Vorstellung seiner Strahlungsformel die Quantenphysik.

Norbert Holtkamp zum Direktor des Fermilab ernannt
Der deutsch-amerikanische Physiker tritt das Amt am 12. Januar 2026 an.
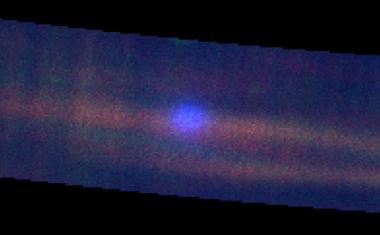
Raumsonde beobachtet interstellaren Besucher
Europa Clipper nimmt Komet 3I/ATLAS „von hinten“ ins Visier seines Ultraviolett-Spektrographen.

Strom statt Wärme
Der Umstieg von Verbrennungsprozessen auf elektrische Energie bringt einen großen Effizienzgewinn mit sich.

Vier Laser für das VLTI
Die umfangreiche Aufrüstung des Paranal-Observatoriums verbessert die Beobachtungskapazität und die Abdeckung des südlichen Sternhimmels.