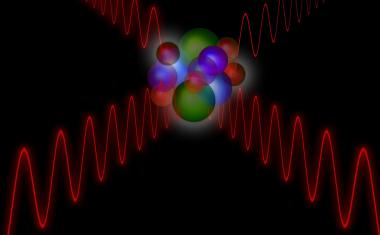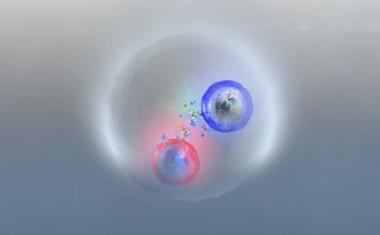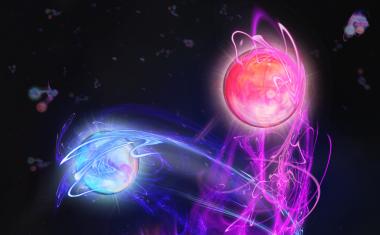MOGON berechnet Wechselwirkung des Pions mit dem Higgs-Feld
Schwer fassbare Niederenergiekonstante aus fundamentaler Theorie ermittelt – Großsimulationen auf Supercomputern sind die einzige Möglichkeit.
Mithilfe von innovativen Großsimulationen auf verschiedenen Supercomputern ist es Physikern der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gelungen, neue Erkenntnisse zu bisher schwer fassbaren Aspekten der Physik der starken Wechselwirkung zu gewinnen: Georg von Hippel und Konstantin Ottnad vom Institut für Kernphysik und dem Exzellenzcluster PRISMA+ haben auf Grundlage der Quantenchromodynamik mit bisher unerreichter Präzision die Wechselwirkung des Pions mit dem Higgs-Feld berechnet.

Eine der Herausforderungen bei der Untersuchung der starken Wechselwirkungen besteht darin, dass sich die Eigenschaften von Teilchen nicht ohne Weiteres direkt aus der QCD berechnen lassen. Stattdessen kommen numerische Methoden, insbesondere die sogenannte Gitter-QCD, zum Einsatz. Bei der Gitter-QCD werden Quarks, Gluonen und deren Interaktionen auf einem diskreten Raster – oder Gitter – von Raum und Zeit simuliert. Diese Methode hat zwar erhebliche Fortschritte ermöglicht, bringt jedoch auch ihre eigenen Schwierigkeiten mit sich: Einerseits müssen die Auswirkungen dieser Beschreibung von Raum und Zeit auf die Berechnungen gut verstanden werden, andererseits benötigen die Simulationen Rechenleistung, die nur von Höchstleistungsrechnern bereitgestellt werden kann.
Bei niedrigen Energien lassen sich die starken Wechselwirkungen häufig besser im Rahmen der chiralen Störungstheorie erklären. Die Bausteine dieses Rahmens sind leichte Mesonen, wie das Pion, die als Wechselwirkungsträger fungieren und die starke Wechselwirkung zwischen Nukleonen vermitteln. Diese Theorie basiert auf den Prinzipien der QCD und umfasst alle Eigenschaften der zugrunde liegenden Quarks und Gluonen. Sie beschreibt die resultierende Physik jedoch auf andere Weise. „Man kann sich das an einer Analogie aus dem Alltag klar machen“, erklärt von Hippel. „Wir alle wissen, dass Wasser aus H2O-Molekülen besteht, aber wenn wir es im Spülbecken vor uns haben, ist es viel praktischer, es als eine Flüssigkeit mit einer bestimmten Dichte, Oberflächenspannung und Viskosität zu beschreiben, die sich aber letztlich natürlich alle aus den Eigenschaften der H2O-Moleküle ergeben."
Um die Eigenschaften der QCD korrekt wiederzugeben, hängt die chirale Störungstheorie von einer Reihe von Niederenergiekonstanten ab. Diese beschreiben die Stärke der verschiedenen Wechselwirkungen der Mesonen untereinander sowie mit externen Feldern wie dem elektromagnetischen Feld. „Einige dieser Niederenergiekonstanten lassen sich praktisch nicht aus experimentellen Daten bestimmen und müssen mithilfe der QCD berechnet werden. Wir haben nun eine derartige Niederenergiekonstante erstmals genau bestimmt. Sie kann als die Stärke der Wechselwirkung des Pions mit dem Higgs-Feld verstanden werden“, erklärt von Hippel.
Großsimulationen der Gitter-QCD auf Supercomputern sind die einzige Möglichkeit, die Niederenergiekonstanten aus der QCD zu berechnen. Dank speziell entwickelter Algorithmen konnten von Hippel und Ottnad nun Gitterergebnisse mit einer um mehr als das Zehnfache höheren Genauigkeit als bisherige Berechnungen erzielen. „Wir konnten einen bisher weitgehend unbekannten Wert mit kontrollierter Genauigkeit aus den Gittersimulationen bestimmen“, so von Hippel. Die Berechnungen führten von Hippel und Ottnad auf Supercomputern des Gauss Centre for Supercomputing am Leibniz Supercomputing Centre und am Jülich Supercomputer Centre sowie auf den Mainzer Hochleistungsrechenclustern Clover, MOGON NHR, MOGON II und HIMster-2 durch.
Ihre Berechnungen haben von Hippel und Ottnad aber nicht nur für die Bestimmung der Niederenergiekonstanten der Chiralen Störungstheorie verwendet. Für eine begleitende Arbeit nutzten sie ihren Ansatz auch, um Beiträge zum Radius des Pions mit noch nie da gewesener Präzision zu berechnen. „Unsere Arbeit zeigt, dass Größen, die bisher als unerreichbar galten, nun für moderne Gitter-QCD-Simulationen zugänglich sind“, fasst von Hippel zusammen. „Unsere Ergebnisse sind ein erster Schritt in eine neue Phase der Gitterrechnungen. In Zukunft wollen wir weitere physikalische Größen wie die Radien von Kaonen oder die Momente von Quarks bestimmen.“ [JGU / dre]
Weitere Informationen
- Originalveröffentlichungen
G. von Hippel & K. Ottnad, Low-Energy Constants of Chiral Perturbation Theory from Pion Scalar Form Factors in 𝑁𝑓=2+1-Flavor Lattice QCD with Controlled Errors, Phys. Rev. Lett. 135, 071904, 13. August 2025; DOI: 10.1103/f4x5-frx1
G. von Hippel & K. Ottnad, Scalar size of the pion from lattice QCD, Phys. Rev. D 112, 034504, 13. August 2025; DOI: 10.1103/qh7q-9nyy - Research, Theory Group, Institut für Kernphysik, Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik, Johannes Gutenberg Universität Mainz