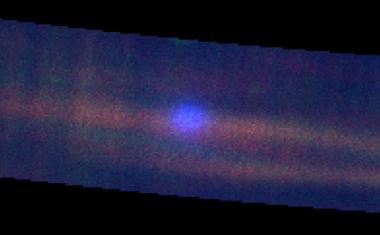Neues Forschungsflugzeug für die TU Braunschweig
Klaus-Tschira-Stiftung ermöglicht den Ausbau der experimentellen Luftfahrtforschung.
Seit über dreißig Jahren heben Wissenschaftler der TU Braunschweig mit einer Dornier Do128-6 „D‑IBUF“ zu Forschungsflügen ab. Diese Mess- und Forschungsflüge sind für verschiedene Disziplinen wichtig, insbesondere für die Grundlagenforschung im Bereich der Meteorologie, zum Beispiel für die Gewitterforschung, um mehr über Meereisprozesse in der Arktis oder über Auswirkungen von Offshore-Windparks auf die Atmosphäre zu lernen. Das Forschungsflugzeug ist das weltweit letzte fliegende Exemplar einer Dornier Do128-6 und wird in spätestens zwei Jahren in den Ruhestand verabschiedet werden.

Ende 2019 nehmen die Forscher schrittweise ein neues Forschungsflugzeug in Betrieb. Ermöglicht wird dies durch eine Förderung der Klaus-Tschira-Stiftung, die den Kauf und die Umrüstung der neuen Maschine mit rund viereinhalb Millionen Euro fördert. Das Flugzeug vom Typ Cessna F406 wird derzeit in Frankreich für seine wissenschaftlichen Missionen umgerüstet.
Über 3500 Studierende der TU Braunschweig und anderer Universitäten konnten an Flugversuchen mit der „D-IBUF“ teilnehmen – beispielsweise im Rahmen von Praktika während des Studiums oder im Rahmen einer Summerschool, die vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der TU Braunschweig regelmäßig ausgerichtet wird.
Auch andere universitäre Einrichtungen in Deutschland nutzten die Maschine für ihre Forschung. So kooperiert die TU Braunschweig mit meteorologischen Lehrstühlen der Uni Hamburg und mit dem Karlsruher Institut für Technologie. Laboreinsätze werden auch für die TU Berlin geflogen.
Gleichzeitig wurde das Forschungsflugzeug in der Vergangenheit in der industrienahen und angewandten Forschung eingesetzt. Dazu gehörten nationale und europäische Projekte im Bereich Satelliten- und Trägheitsnavigation und neuartige, umweltverträgliche und lärmarme Anflugverfahren.
So hat das Forschungsflugzeug der TU Braunschweig wesentlich zur Entwicklung der GBAS-Technologie, dem Ground Based Augmentation System, also satellitennavigationsbasierten Präzisionsanflugverfahren, beigetragen. Damit wurde der Weg für die Umsetzung neuartiger lärmreduzierter Anflugverfahren geebnet, zum Beispiel durch gekrümmte oder segmentierte Anflugpfade. Darauf aufbauende Versuche wurden 2018 mit einer Boeing 777F in den USA erfolgreich durchgeführt. Auch mit dem Nachfolgeflugzeug der TU Braunschweig soll in diesem Projekt weiter geforscht werden.
Mit dem neuen Flugzeug, einer gebrauchten und modernisierten Cessna F406, können Forscher weitere Strecken zurücklegen und schneller ihre Messpunkte erreichen. Die maximale Reichweite liegt bei 2200 Kilometern, die Reisegeschwindigkeit bei etwa 437 Kilometern pro Stunde. Zum Vergleich: Das aktuelle Forschungsflugzeug erreicht 1200 Kilometer sowie 260 km/h und gehört damit bereits zu den Spitzenreitern im universitären Bereich, wo meist kleinere Maschinen, etwa Motorsegler, zum Einsatz kommen.
Das neue Forschungsflugzeug wird Ende 2019 zu ersten Testflügen abheben. Im Vorfeld wird das Flugzeug umgerüstet und mit präziseren Messgeräten ausgestattet, die Umgebungs- und Flugzeugdaten erfassen. Dazu gehören etwa die Windrichtung und -stärke, Turbulenzen, Luftfeuchte, Lufttemperatur, Luftdruck, einfallende und reflektierte Sonnenstrahlung, Bewegung und Position des Flugzeuges, Stellungen der Ruderorgane sowie Triebwerksparameter. Außerdem werden Sensoren und Antennen am Flugzeug angebaut sowie Öffnungen im Kabinendach und -boden vorbereitet, die zum Beispiel für spätere Kamerainstallationen genutzt werden können. Zusätzlich wird ein „Nasenmast“ installiert, um Sensoren in möglichst ungestörter Anströmung vor dem Flugzeug platzieren zu können.
TU Braunschweig / RK
Weitere Infos