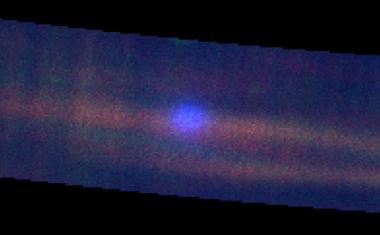Planetenjäger Carmenes erfolgreich getestet
Forscher erhoffen sich Informationen über erdähnliche Planeten von dem neuen hochauflösenden Spektrographen.
Nach fünfjährigen Vorarbeiten haben Forscher erstmals das neue Messinstrument Carmenes am Calar-Alto-Observatorium in Südspanien getestet. Es besteht aus zwei Spektrometern, die das sichtbare und infrarote Licht von astronomischen Objekten analysieren können und die beide für die Entdeckung von Planeten naher Sterne optimiert wurden. Carmenes wurde gemeinsam von elf deutschen und spanischen Projektpartnern geplant und gebaut, darunter das Institut für Astrophysik der Uni Göttingen.
Abb.: Kuppel des 3,5-Meter-Teleskops, Calar Alto, Südspanien, an dem Carmenes getestet wurde. (Bild: Carmenes-Konsortium)
Carmenes ist spezialisiert auf Planeten, die um M-Sterne kreisen. Dabei handelt es sich um kleinere und leuchtschwächere Sterne, die Planeten mit sternnahen Bahnen angenehme Temperaturen bieten. M-Sterne senden ihr Licht hauptsächlich im nah-infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums aus. Carmenes ist in diesem Bereich so empfindlich wie derzeit kein anderes astronomisches Instrument. Gleichzeitig ist Carmenes in der Lage, aufgrund seiner ausgeklügelten Technologie und extrem hohen Stabilität die kleinsten Bewegungen von Sternen zu messen. Dadurch können die Forscher Rückschlüsse auf die Existenz des Planeten ziehen.
„Durch die Kombination der Daten beider Spektrographen erhalten wir erheblich mehr Informationen als mit ähnlichen Vorgängerinstrumenten“, erläutert Ansgar Reiners vom Institut für Astrophysik der Uni Göttingen. „Das hilft uns, zwischen Flecken auf der Sternoberfläche und Bahnbewegungen der Sterne aufgrund der Anwesenheit von Planeten zu unterscheiden. Wir hoffen deshalb, dass wir in den kommenden Jahren Dutzende von Planeten entdecken, die möglicherweise in der Lage sind, Leben zu beherbergen.“
Die Astrophysiker hoffen, bereits am 1. Januar 2016 die ersten wissenschaftlichen Daten aufnehmen zu können. Bei der Projektentwicklung waren sie unter anderem verantwortlich für die Anpassung der Spektrographen an die wissenschaftliche Fragestellung, sowie für die zwei Kleinbus-großen Vakuumtanks, in denen die Spektrographen von äußeren Einflüssen abgeschirmt werden. Darüber hinaus wurde die Software zur Verarbeitung der Daten in Göttingen erstellt. Bei dem Projekt kommen neuartige Kalibrierungsmethoden zum Einsatz, die am Institut für Astrophysik der Uni Göttingen entwickelt wurden.
GAU / RK