
Quantentunneln in der Makrowelt
Physikkonkret Ausgabe 75 widmet sich dem Physik-Nobelpreis 2025 und ordnet die preisgekrönten Arbeiten in den Kontext des Internationalen Quantenjahres ein.
Mit Kooperationen und Spitzenforschung behauptet sich Karlsruhe im globalen Vergleich. Auch Stuttgart und München können punkten.
In der Leibniz Universität Hannover fand am 14. November 2025 zum zweiten Mal „Die Große MaPhy-Show“ statt.

Physikkonkret Ausgabe 75 widmet sich dem Physik-Nobelpreis 2025 und ordnet die preisgekrönten Arbeiten in den Kontext des Internationalen Quantenjahres ein.

Der Ig Nobel-Preis in der Kategorie Physik geht an ein Forschungsteam aus Italien, Spanien, Deutschland und Österreich für die Anleitung zu perfekter „Cacio e Pepe“-Pasta.

Zum 100. Geburtstag des Physik-Nobelpreisträgers Roy Glauber.
 • 7/2025 • Seite 42
• 7/2025 • Seite 42Die Wissenschaftlerin hinter dem Bohr-van-Leeuwen-Theorem
Das Bohr-van-Leeuwen-Theorem besagt, dass Magnetismus nicht klassisch erklärbar ist, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein echtes Quantenphänomen handeln muss. Dass es nach Bohr benannt ist, ist vielleicht nicht so überraschend, aber wer war van Leeuwen?
Als Hendrika Johanna „Jo“ van Leeuwen 1919 ihre Dissertation bei Hendrik Lorentz abschloss, war sie nicht seine erste Doktorandin. Drei weitere Frauen hatten ebenfalls bei ihm promoviert: seine eigene Tochter Berta und Johanna Reudler im Jahr 1912 sowie Eva Bruins im Jahr 1918. Die vier gehörten zu den ersten Frauen, die in den Niederlanden Physik auf universitärem Niveau studieren konnten. Das war in den Niederlanden wie auch anderswo in Europa keine Selbstverständlichkeit. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts bahnten sich Frauen langsam ihren Weg an die Universitäten, die ihnen bis dahin nur zögerlich ihre Türen geöffnet hatten. Ihr Fortkommen wurde oft durch eine unzureichende Vorbildung behindert, vor allem wenn sie sich für die Wissenschaft interessierten. Die Hogere Burger School (HBS), die zusammen mit einem zusätzlichen Staatsexamen in Griechisch und Latein für viele Jungen den Weg zu einem naturwissenschaftlichen Studium ebnete, nahm bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in der Regel keine Mädchen auf. In den mittlerweile eingerichteten speziellen HBS-Schulen für Mädchen wurden die Fächer Physik und Mathematik weitgehend durch Handarbeit und Hauswirtschaft ersetzt.
Jo van Leeuwen und ihre jüngere Schwester Nel hatten das Glück, dass ihre fortschrittlichen Eltern sie an der Haager Knabenschule anmeldeten, als diese 1901 die Aufnahme von Mädchen erlaubte, was damals noch einer ministeriellen Ausnahmegenehmigung bedurfte. Außerdem erlaubten sie ihren beiden Töchtern, die staatliche Ergänzungsprüfung in Griechisch und Latein abzulegen und anschließend in Leiden Physik zu studieren. Dort begann Jo dann 1914 ihre Doktorarbeit bei Lorentz [1]. (...)
 • 1/2025 • Seite 26 • DPG-Mitglieder
• 1/2025 • Seite 26 • DPG-MitgliederGibt es eine gute Geschichtsschreibung der Quantenphysik, und wenn ja, wieso sollte sie uns interessieren?
Hundert Jahre Quantenmechanik sind eine gute Gelegenheit, um sich der Geschichte der Quantenphysik zuzuwenden. Sicher fehlt es auch im von der UNESCO ausgerufenen Internationalen Jahr der Quantenwissenschaften und -technologien nicht an den altbekannten Anekdoten und plakativen Geschichten. Doch so eingängig diese auch sein mögen, stehen sie meist nicht mit der dokumentierten Geschichte der Physik im Einklang. Die folgenden Beispiele für „Quantenmythen“ zeigen, dass sich hinter ihnen oft eine reiche, meist auch spannendere Geschichte verbirgt. Das vermittelt einen Einblick in die verschiedenen Formen der Physikgeschichte und beleuchtet deren jeweilige Stärken und Schwächen.
Vor einiger Zeit erhielt ich per E-Mail eine Anfrage, ob die auf Wikipedia zu findende Behauptung, dass Max Planck (Abb. 1) die Konstante h für „Hilfsgröße“ eingeführt hätte, irgendwo belegt sei. In den Schriften von Planck sei dies nicht zu finden. Einmal für diese Hilfsgrößen-These sensibilisiert, stößt man an vielen Stellen auf sie. Insbesondere populäre Bücher erzählen gern die Geschichte der als Hilfsgröße eingeführten Konstante, die sich später erst als wichtigstes Element von Plancks Theorie herausgestellt hätte, und bisweilen hört man dies auch zu offiziellen Anlässen in Physikinstituten. Doch diese Schilderung passt weder zur historischen Entwicklung der Strahlungsgesetze noch zu Plancks Vorgehen in der Physik. (...)

Am Massachusetts Institute of Technology wurden die diesjährigen Ig Nobel Prizes verliehen.

Vor 100 Jahren wurde der britische Physik-Nobelpreisträger Antony Hewish geboren.
Interview mit Christoph Schürmann
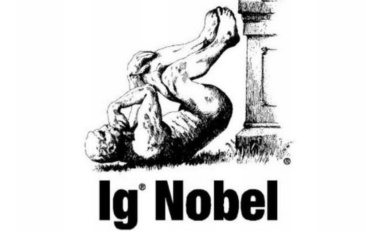
Ein US-Biologe und ein Forschungsteam erhalten den Ig Nobel-Preis für Physik 2022 für ihre Versuche, das Formationsschwimmen von Entenküken zu verstehen.

Effekt tropfender Teekannen theoretisch und experimentell untersucht.
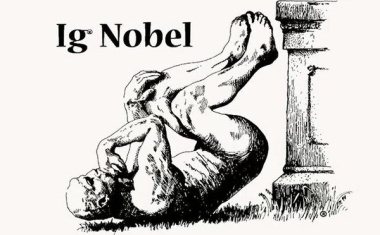
Zwei der zehn diesjährigen Ig Nobel-Preise gehen an Arbeiten, die das Verhalten von Fußgängern untersucht haben.
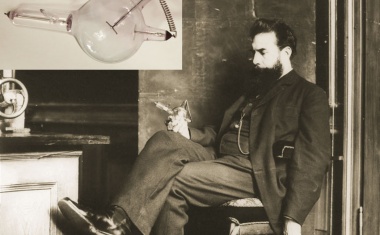 • 12/2020 • Seite 48 • DPG-Mitglieder
• 12/2020 • Seite 48 • DPG-MitgliederRöntgens Strahlen und Lenards Röhren im Lichte wenig beachteter oder erst kürzlich aufgefundener Dokumente.
Am Abend des 8. November 1895 fand der in Würzburg lehrende Physikprofessor Wilhelm Conrad Röntgen (1845 – 1923) bei Experimenten mit Gasentladungsröhren erste Hinweise auf eine „neue Art von Strahlen“ von bisher nicht bekannter Durchdringungsfähigkeit. In einer außergewöhnlich intensiven und von der Außenwelt abgeschirmten Arbeitsphase verifizierte und systematisierte er seine Entdeckung der zunächst von ihm so genannten „X-Strahlen“. In den Weihnachtstagen 1895 bereitete er seine Ergebnisse zum Druck in den wenig bekannten „Sitzungsberichten der Würzburger Phys.-medic. Gesellschaft“ vor [1] und verschickte die Separatdrucke in den ersten Januartagen 1896 an die bekanntesten Vertreter seines Fachgebietes. Ein Sturm brach los. Der Röntgenbiograph Otto Glasser zählte für 1896 über tausend Publikationen zur Nachstellung, Variation und Nutzbarmachung von Röntgens Experimenten. Nie zuvor und selten danach hatten Wissenschaftler und Techniker – hier Physiker, Mediziner, Elektrotechniker und Glasbläser – einer wissenschaftlichen Entdeckung so schnell zum Durchbruch und zur Nutzung verholfen.
Es fehlte nicht an konkurrierenden Prioritäts ansprüchen. Aber letztlich entsprachen sie alle der Erkenntnis, dass man spätestens seit der in der Mitte des 19. Jahrhunderts von dem in Bonn tätigen Glastechniker Heinrich Geißler angesto-ßenen Gas entladungsforschung die neuen Strahlen zwar immer wieder erzeugt, manchmal auch indirekt bemerkt hatte, aber doch nie entdeckt und beschrieben. Von ganz anderem Kaliber war der Seitenhieb, den Philipp Lenard in seinem Nobel-Vortrag am 28. Mai 1906 austeilte: Röntgen habe seine Entdeckung als erster Nutzer der von ihm, Lenard, entworfenen Fenster-Röhre „ganz notwendigerweise“ machen müssen. „Es treffen in ihr die ... Kathodenstrahlen die große Fläche des Platins, welches sie, wie man heute weiß, am besten in die damals noch nicht bekannten Röntgenstrahlen verwandelt.“ (...)
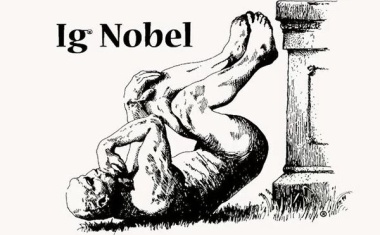
Der Ig Nobel-Preis für Physik 2020 geht an Forscher, die das Verhalten von Regenwürmern bei Vibrationen mit hohen Frequenzen untersucht haben.

Erstmals seit 24 Jahren gibt es keinen Ig Nobel-Preis für Physik.
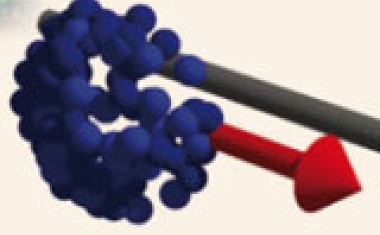 • 11/2017 • Seite 24
• 11/2017 • Seite 24Im Quark-Gluon-Plasma können Wirbel entstehen, die deutlich stärker sind als in allen anderen Systemen.
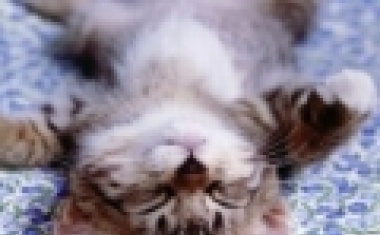
Den diesjährigen Ig Nobel-Preis für Physik erhält der Franzose Marc-Antoine Fardin für seine rheologischen Untersuchungen an Katzen.
 • 10/2017 • Seite 49
• 10/2017 • Seite 49Die Geschichte der Physik bietet neue Zugänge, um Fachwissen und Kompetenzen zu entwickeln.
Im Physikunterricht hat die Geschichte der Physik lange nur eine geringe Rolle gespielt. Bedingt durch veränderte schulische Bildungsziele haben historisch orientierte Unterrichtsansätze im deutschen Sprachraum an Bedeutung gewonnen – eine Entwicklung, die vergleichbar auch in Nordamerika und anderen westeuropäischen Ländern stattfindet. Zwei konkrete Ansätze sollen zeigen, welches Potenzial die Geschichte der Physik für die Schule bietet.
Die Geschichte der Physik wurde schon seit langer Zeit im Hinblick auf naturwissenschaftliche Bildungsprozesse dargestellt. Klassische Arbeiten wie die von Einstein und Infeld verfasste Monographie [1] oder die durch J. B. Conant herausgegebenen Fallstudien [2] entstanden aus dem Interesse heraus, zu einer naturwissenschaftlichen Bildung beizutragen. Dabei bezogen sie sich auf einen Unterricht, der im Wesentlichen auf die Vermittlung von Fachwissen abzielte. Der in den letzten zehn Jahren etablierte kompetenzorientierte Physikunterricht stellt aber Anforderungen, die sich durch die Ergänzung der bestehenden Ansätze mittels historisch angelegter Unterrichtssequenzen oder -stunden gut erfüllen lassen. Die aktuellen Bildungsstandards für den Physikunterricht fordern einerseits, dass der Unterricht Fachwissen vermitteln soll. Andererseits gilt es, prozedurale Kompetenzen zu fördern – diese unterteilen sich in die Bereiche Bewertung, Erkenntnisgewinn und Kommunikation. Eine separate Entwicklung dieser Kompetenzen ist nicht ratsam, sondern eine eng miteinander verknüpfte Förderung. Die Geschichte der Physik ermöglicht es, fachwissenschaftliche und prozedurale Kompetenzen gemeinsam zu entwickeln. Hierfür existieren verschiedene Ansätze – speziell im deutschen Sprachraum hat sich das Nachvollziehen historischer Experimente etabliert [3, 4]. Obwohl dieser Ansatz aus dem klassischen lernzielorientierten Physikunterricht stammt, eignet er sich auch für den kompetenzorientierten Fall...

Der diesjährige IgNobelpreis für Physik geht an Forscher, welche die Auswirkung von polarisiertem Licht auf Libellen und Bremsen untersucht haben.
 • 4/2016 • Seite 16
• 4/2016 • Seite 16Mit Hilfe der beiden LIGO-Detektoren ist es erstmals gelungen, Gravitationswellen direkt zu messen.

Diesjähriger IgNobel-Preis für Physik geht an Forscher, welche die Blasenentleerung von Säugetieren untersucht haben.
 • 7/2015 • Seite 41
• 7/2015 • Seite 41Die Allgemeine Relativitätstheorie etablierte sich von 1915 bis 1990 nur langsam als eigene Disziplin.
Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) war zwar nach der Bestätigung der gravitativen Lichtablenkung im Jahr 1919 in aller Munde, prägte aber die physikalische Forschung im Gegensatz zur aufkommenden Quantenmechanik kaum. Zwar befassten sich immer wieder einzelne Physiker mit Fragen der ART, aber eine Institutionalisierung im Lehr- und Forschungsbetrieb fand im deutschen Sprachraum erst deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg statt.
Mit der Aufstellung der Feldgleichungen für seine relativistische Gravitationstheorie vollendete Albert Einstein im November 1915 in Berlin seine jahrelangen Bemühungen. Zu dieser Zeit waren viele deutsche und österreichische Naturwissenschaftler und Mathematiker wegen des Ersten Weltkriegs zum Militär eingezogen worden. Schon im Dezember 1915 schickte der Astronom Karl Schwarzschild von der russischen Front aus eine exakte Lösung für einen kugelsymmetrischen Stern (Innen- und Außenraum) an Einstein, die fünfzig Jahre später der Prototyp für ein „Schwarzes Loch“ werden sollte. Jeder, der sich mit partiellen Differentialgleichungen auskannte, konnte sofort etwas zur neuen Theorie beitragen. Daher waren wichtige exakte Lösungen der Einsteinschen Feldgleichungen wie etwa die Reissner-Nordström und – für die Feldgleichungen mit kosmologischer Konstante – die de-Sitter-Lösung schon bis 1917 gefunden.
Die an Physik interessierte Öffentlichkeit wies 1916 ein Büchlein des jungen Potsdamer Astronomen Erwin Freundlich auf die neue Theorie hin. 1917 legte Einstein eine eigene Darstellung für einen größeren Leserkreis vor: „Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich“. Auch Philosophen wie Moritz Schlick richteten schon 1917 ihr erkenntnistheoretisches Interesse auf Einsteins Gravitationstheorie. Einstein korrespondierte mit praktisch allen, die über Allgemeine Relativitätstheorie forschten oder sich dazu kritisch äußerten. Die von ihm vertretene physikalische Bedeutung der allgemeinen Kovarianz seiner Theorie stellte Erich Kretschmann 1917 in Frage. Die Fachwelt hatte also bereits vor dem Ende des Ersten Weltkriegs wesentliche Eigenschaften der ART beschrieben und Folgerungen aus ihr gezogen (kosmologische Modelle, Gravita-tionswellen)...

Der diesjährige IgNobel-Preis für Physik geht an japanische Forscher, die den Reibungskoeffizienten unter einer Bananenschale gemessen haben.
Interview mit Wolfgang Ketterle

Biomechanik und Materialforschung einmal anders – die Ig Nobel-Preise 2009 für Physik und Chemie.
Highlights aus dem Programm der Sektion Atome, Moleküle, Quantenoptik und Plasmen (SAMOP)
Die Grenzfläche zwischen zwei isolierenden Oxiden lässt sich mit einem elektrischen Feld zwischen dem supraleitenden und dem isolierenden Zustand hin- und herschalten.