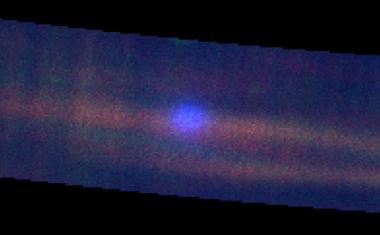Gequetschtes Licht für Virgo
Maßgeschneiderte Lichtquelle soll Empfindlichkeit des Gravitationswellen-Detektors erhöhen.
Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik – Albert-Einstein-Institut AEI – in Hannover und des Instituts für Gravitationsphysik der Leibniz Universität Hannover hat für den Gravitationswellen-Detektor Virgo nahe Pisa eine Quetschlichtquelle entwickelt. Nun lieferten Hannoveraner Forscher den Aufbau dorthin, nahmen ihn in Betrieb und übergaben ihn an die Virgo-Kollegen. Damit soll Virgo ab Herbst 2018 gemeinsam mit dem weltweiten Netzwerk der Gravitationswellen-Detektoren empfindlicher nach Gravitationswellen lauschen als jemals zuvor.
Abb.: AEI-Forscher installieren gemeinsam mit Virgo-Kollegen die in Hannover entwickelte Quetschlichtquelle in einem Reinraum am Gravitationswellen-Detektor Virgo. (Bild: H. Lück, B. Knispel, AEI)
„Beim deutsch-britischen Gravitationswellen-Detektor GEO600 nahe Hannover kommt seit 2010 eine Quetschlichtquelle routinemäßig zum Einsatz. Sie hat das von GEO600 belauschte Universum bis zu viermal vergrößert“, sagt Karsten Danzmann, Direktor am AEI Hannover. „Die Entwicklung und Perfektion dieser Spitzentechnologie ist ein weiteres erfolgreiches Kapitel in der Geschichte von GEO600 als Ideenschmiede der weltweiten Gravitationswellen-Forschungsgemeinschaft.“
Die beiden US-amerikanischen LIGO-Instrumente und der Virgo-Detektor in der Toskana werden derzeit in Vorbereitung auf den nächsten gemeinsamen Beobachtungslauf O3, der im Herbst 2018 beginnen soll, weiter ausgebaut und verbessert. Mit O3 soll die kürzlich begonnene Gravitationswellen-Astronomie durchstarten: Die weltweite Forschergemeinschaft erwartet eine Vielzahl weiterer Gravitationswellensignale von verschmelzenden Schwarzen Löchern und erneute Nachweise verschmelzender Neutronensterne.
Virgo erhielt dafür nun eine wertvolle Ergänzung aus Hannover: Eine Quetschlichtquelle soll die Empfindlichkeit von Virgo mit dem Beginn von O3 deutlich verbessern. Der maßgeschneiderte Aufbau ist eine Dauerleihgabe des AEI an Virgo. In allen interferometrischen Gravitationswellen-Detektoren – LIGO, Virgo und GEO600 – ist die Empfindlichkeit für die Kräuselungen der Raumzeit, die von kosmischen Großereignissen zeugen, von quantenmechanischen Effekten grundlegend begrenzt. Diese rufen ein Hintergrundrauschen hervor, welches das mittels Laserlicht zu messende Gravitationswellensignal überlagert.
„Dieses Hintergrundrauschen tritt selbst bei vollkommener Dunkelheit auf und lässt sich niemals vollkommen beseitigen. Wir können es aber so verändern – wir nennen das dann quetschen –, dass es die Gravitationswellen-Messung weniger stört“, sagen Henning Vahlbruch und Moritz Mehmet vom AEI Hannover, die die Quetschlichtquelle gebaut und am Virgo-Detektor in Betrieb genommen haben. „Unser Aufbau erzeugt gewissermaßen eine Dunkelheit, die besser ist als die Natur normalerweise erlaubt – mit diesem veränderten Rauschen steigern wir die Empfindlichkeit der Detektoren.“
Die Empfindlichkeit aller interferometrischen Gravitationswellen-Detektoren lässt sich langfristig nur durch die Verwendung von ähnlichen Quetschlichtquellen weiter steigern. Auch geplante Detektoren der dritten Generation wie das europäische Einstein Teleskop werden auf diese Technologie angewiesen sein.
AEI / JOL