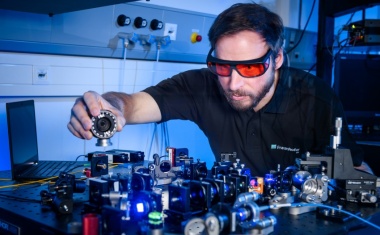Kühn dorthin gehen, wo noch niemand war
Quantenkommunikation via Satellit ist das Titelthema in der neuen „Physik in unserer Zeit“.
Christoph Marquardt
Eine Reihe fundamentaler Fragen führte zur Entwicklung der Quantenmechanik, deren wesentlicher Kern dieses Jahr sein hundertjähriges Jubiläum feiert. In den letzten Jahrzehnten haben die damit verbundenen Fragestellungen auch zu konkreten industriellen Quantentechnologien geführt. Erkennbar ist dieser Übergang am Physik-Nobelpreis von 2022, mit dem Alain Aspect, John F. Clauser und Anton Zeilinger für ihre grundlegende Untersuchung der Verschränkung geehrt wurden, die hinter vielen wichtigen Anwendungen steht.

Viele dieser Anwendungen, etwa im Quantencomputing, setzen voraus, dass man neben der Verarbeitung von Quantenzuständen auch deren Ausbreitung meistern kann. Die besonders hilfreichen Eigenschaften dieser Quantenzustände, darunter die Verschränkung, sind fragil und leiden unter Verlusten und Wechselwirkung mit der Umgebung. Dennoch ist es in letzter Zeit gelungen, Konzepte zu entwickeln, die Quantenkommunikation auch über größere Distanzen ermöglichen.
Quantencomputer würden die Sicherheit der aktuell in der Kryptografie eingesetzten asymmetrischen Verschlüsselung bedrohen. Doch die Quantenmechanik liefert auch ein Gegenmittel: Die Quantenschlüsselverteilung bietet eine quantifizierbare Sicherheit, die auf elementaren quantenphysikalischen Prinzipien fußt. Die dazu nötige Quantenkommunikationstechnologie wird derzeit in vielen nationalen und europäischen Initiativen erforscht und weiterentwickelt.
Dass die Quantenkryptografie in Quantennetzwerken prinzipiell funktioniert, wurde über kurze und mittlere Distanzen in Glasfasernetzen demonstriert, und es gibt bereits kommerzielle Anbieter. Doch weite Distanzen – Stichwort Quantenrepeater – stellen noch eine große Herausforderung an die Forschung dar. Eine Alternative bietet die Quantenkommunikation via Satellit, was bei den zu überbrückenden großen Distanzen in deren Orbits erst einmal erstaunt. Allerdings propagieren die Quantenzustände bei der weltraumgestützten Quantenkommunikation überwiegend im Vakuum und leiden deswegen unter deutlich weniger Verlust.
Vorschläge für den Satelliteneinsatz gab es schon vor über zwei Jahrzehnten. Nach vielen Vorarbeiten, die zu einem großen Teil in Europa geleistet wurden, hat sich daraus heute ein sehr aktives Gebiet entwickelt. 2016 gelang der chinesischen Micius-Mission die erste Übertragung eines Quantenkommunikationsprotokolls per Satellit, was Demonstrationscharakter hatte. Danach folgten weltweit viele Aktivitäten, die sowohl die konkrete Anwendung zur Verteilung von geheimen Schlüsseln als auch die Übertragung von allgemeinen Quantenzuständen per Satellit zum Ziel haben. Letztere sollen die Verarbeitung von entfernten Quantenzuständen ermöglichen oder neue Bereiche wie die Quantenastronomie eröffnen.
In Deutschland gelang es im BMBF-geförderten Projekt QUBE, den ersten Kleinstsatelliten, einen Cubesat, zu starten. Dieser schickt Quantenzustände zur Erde und nutzt photonisch-integrierte Quantentechnologie. Die ersten wissenschaftlichen Experimente mit QUBE werden zurzeit durchgeführt. Sein Nachfolger QUBE-II, der einen vollständigen Quantenschlüsselaustausch ermöglichen soll, ist gerade in Entwicklung. Auf europäischer Ebene bereitet die EAGLE-I-Mission der ESA mit einem Konsortium um den Satellitenprovider SES den ersten europäischen Satelliten vor. Dieser soll Quantenkryptografie eingebettet in ein vernetztes System mit Bodenstationen demonstrieren, die über Europa verteilt sind.
Diese anspruchsvollen Projekte sind nur durch eine sehr enge und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung realisierbar. Die schon weit vorangeschrittene Entwicklung der satellitenbasierten Quantenkommunikation kann dabei als Rollenmodell für andere Quantentechnologien dienen. Wir befinden uns in einer extrem spannenden Zeit, in dem die Grundlagenforschung in Anwendungen überführt wird, begleitet von einem sehr aktiven Ökosystem von Start-Ups. Der Beitrag des Autorenteams um Kai Bongs in der aktuellen „Physik in unserer Zeit“ bietet eine sehr hilfreiche Einführung und Überblick in die lebendige Thematik, die auch sehr gut zu einigen Aspekten in neueren Lehrplänen an den Schulen passt.
All diese konkreten Anwendungen dienen auch wieder als Rückkopplung in die Grundlagenforschung. Bei der satellitenbasierte Quantenkommunikation spielt die relativistische Quanteninformationsübertragung eine Rolle, deswegen bieten diese Systeme auch die Möglichkeit, speziell die Quantenmechanik unter extremen Bedingungen zu testen. Und so führt uns das wieder zurück zu den fundamentalen Fragen, frei nach dem Motto „to boldly go where no one has gone before“.