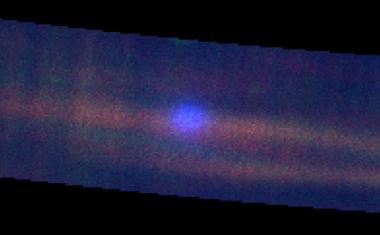Speed-Kick im Eistunnel
Bob, Skeleton und Rodeln sind rasant und spektakulär. Die aktuelle „Physik in unserer Zeit“ erklärt Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei olympischen Sportarten.
Sigrid Thaller & Leopold Mathelitsch
Die drei olympischen Sportarten Bob, Skeleton und Rodeln nutzen die gleichen Grundlagen: Nach dem Start wirkt als treibende Kraft allein die Schwerkraft, es wird auf derselben Eisbahn gefahren, die Prinzipien der physikalischen Wechselwirkung zwischen Eis und Kufen sind gleich, Maßnahmen gegen den Luftwiderstand nutzen dieselben Gesetzmäßigkeiten. Die Sportgeräte allerdings unterscheiden sich erheblich in der Sitzhaltung der Fahrer, in Startphase und Lenkung. Der Bobsport gilt als Formel 1 des Wintersports, wegen der hohen Geschwindigkeiten bis zu 150 km/h und der technischen Perfektion der Geräte.

Damit eine Eisbahn international anerkannt wird, muss sie bestimmten Regeln gehorchen. Sie muss etwa 1,5 km lang sein mit einem Höhenunterschied von 120 m; die Steigung sollte im Mittel 8,6 % betragen, wobei maximale Werte bis zu 15 % erlaubt sind. Gefordert sind mindestens fünf stark überhöhte Kurven mit einem Radius von 25 m. Die maximale Belastung bei einer Durchfahrtszeit von 2 s durch eine solche Kurve soll nicht mehr als 5 g betragen. Für die Schlitten gelten strenge Regeln bezüglich Größe, Form und Material. Dies soll einerseits der Sicherheit der Athleten dienen, aber auch eine Dominanz technisch starker Nationen verhindern.
Abgesehen vom Start liefert die Gravitation die maßgebliche Beschleunigung der Fahrzeuge. Dementsprechend wichtig sind Reglements für die beteiligten Massen. Das schwerste und größte Gerät ist der Bob. Die Minimalmasse eines Zweierbobs muss 170 kg betragen, inklusive der Mannschaft darf eine Masse von 390 kg für Männer und 330 kg für Frauen nicht überschritten werden. Beim Viererbob liegt die Grenze des Gesamtgewichts bei 630 kg. Wesentlich leichter sind Rennrodelschlitten für Damen und Herren mit einer Masse zwischen 21 kg und 25 kg, Doppelsitzer zwischen 25 kg und 30 kg. Männer dürfen im Rodelsport ein Höchstgewicht von 90 kg haben, Frauen von 75 kg. Für Skeletonschlitten sind bei Frauen eine Maximalmasse von 38 kg und eine Gesamthöchstmasse von 102 kg sowie bei Männern jeweils 45 und 120 kg erlaubt.
Regeln für Größe und Form der Vorderseite der Geräte sollen die Geschwindigkeit vermindern und die Bedingungen vereinheitlichen. Sowohl Zweier- als auch Viererbobs sind 85 cm breit. Ein Zweierbob ist 3,2 m lang bei einem Achsenabstand von 1,69 m, ein Viererbob mit 3,8 m ist nur um 60 cm länger. Ein Skeleton hat eine Schlittenlänge von 80 bis 120 cm, eine Gesamthöhe von 8 bis 20 cm und eine Kufenspurbreite zwischen 34 und 38 cm. Eine Rennrodel darf nur 15 cm hoch und 55 cm breit sein, die Länge liegt zwischen 1,24 und 1,34 m.
Warum auch die Länge durch die Regeln genau vorgeschrieben ist, zeigt ein Blick in die Geschichte: Bevor die Länge der Bobs genau vorgegeben war, wurden viele Untersuchungen zur Optimierung der Fahreigenschaften durchgeführt. Eine physikalisch besonders simple, aber dennoch wirkungsvolle Idee hatte der deutsche Physiker und Sportwissenschaftler Martin Sust, als er den DDR-Bob für die Olympischen Spiele 1976 einfach ein paar Zentimeter kürzte. Dadurch löste der Schlitten die Zeitnehmung am Start und im Ziel jeweils etwas später aus. Da sich der Bob zum Startzeitpunkt langsamer bewegte als im Ziel, war die Zeitdifferenz beim Start zwischen kurzem und langem Bob größer als im Ziel. Das brachte in jedem Teillauf einen Zeitvorteil, der sich aufsummierte. Nimmt man für den Start eine Anlaufgeschwindigkeit von 30 km/h an, für das Ziel eine Geschwindigkeit von 140 km/h, so ergibt sich bei 10 cm Längenunterschied in jedem Teillauf ein Zeitgewinn von fast einer hundertstel Sekunde, was bei vier Durchläufen schon eine wesentliche Rolle spielen kann.
In dieser Folge von „Sportphysik“ in der „Physik in unserer Zeit“ analysieren wir für diese drei Sportarten die Aerodynamik, die Wechselwirkung zwischen Kufe und Eis, die wichtige Startphase und das Steuern und Bremsen der Schlitten. Den Schlusspunkt bildet die Frage, wie gefährlich die teils spektakulären Unfälle tatsächlich sind. Der volle Artikel ist unter dem unten angegebenen Link frei verfügbar.