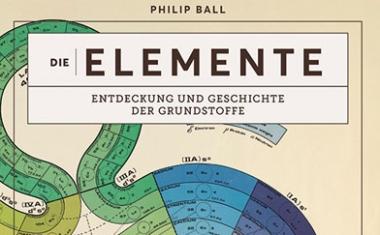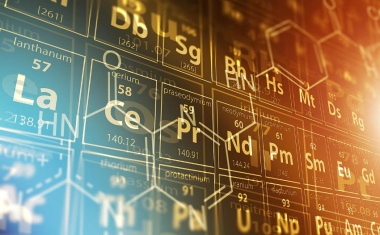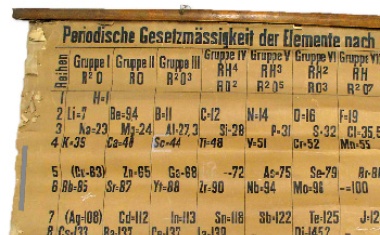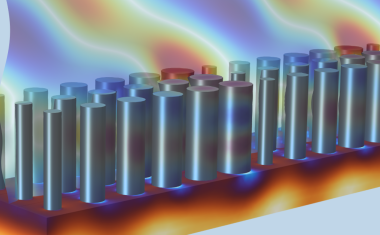Elementare Entdeckerin
Vor 50 Jahren starb Marguerite Perey, die Entdeckerin des Elements Francium und erstes weibliches Mitglied der Académie des Sciences.
Anne Hardy

„Heldin der Radiologie, erste Frau an der Académie des Sciences, im Dienste der Wissenschaft erkrankt“, so titelte eine französische Zeitung im Jahr 1962. Unter großem Aufsehen war die Physikerin Marguerite Perey als erste Frau zum korrespondierenden Mitglied der Académie des Sciences gewählt worden. Ihre Entdeckung des radioaktiven Elements Francium war 1939 gänzlich unbeachtet geblieben. Zu sehr beschäftigte die Franzosen seinerzeit die Angst vor einem bevorstehenden Krieg mit Hitler-Deutschland.
Zum Nimbus der 53-jährigen trug ihre frühere enge Zusammenarbeit mit Marie Curie bei. Mit 19 Jahren hatte Marguerite Perey als deren Laborassistentin begonnen. In Interviews betonte sie später oft: „Ich verdanke Marie Curie alles.“ Wie ihre Mentorin litt auch Margueritte Perey an den Folgen des ungeschützten Umgangs mit Radioaktivität. Ein Fingerglied hatte amputiert werden müssen, was eine weitere Schlagzeile aufgriff: „Die junge Chemikerin, die das Element 87 entdeckte, bedauert nur eines: Dass sie nicht mehr Chopin spielen kann.“
Feministinnen hofften, dass Marguerite Pereys Wahl in die Akademie auch anderen Frauen die Tür öffnen würde. 1910 war Marie Curie, die sich als erste weibliche Kandidatin zur Wahl gestellt hatte, gescheitert – obwohl sie ihren ersten Nobelpreis bereits erhalten hatte. Auch ihre Tochter Irène, die den Nobelpreis 1935 mit ihrem Mann Frédérique Joliot teilte, wurde nicht in den Kreis der „Unsterblichen“ aufgenommen. Tatsächlich sollte es noch 16 Jahre dauern, bis 1978 die zweite Frau, Yvonne Choquet-Bruhat, in die Akademie gewählt wurde.
Marguerite Perey, geboren am 19. Oktober 1909 in Villemomble bei Paris, hatte ursprünglich Medizin studieren wollen. Als aber der Vater, ein Müller, im Ersten Weltkrieg starb, gerieten seine Witwe und ihre fünf Kinder in eine schwierige finanzielle Lage. Marguerite besuchte daher nach der Schule die École d'Enseignement Technique Feminine, die sie 1929 als chemisch-technische Assistentin abschloss. Bei ihrem Vorstellungsgespräch im Radium-Institut kam eine unscheinbare, schwarz gekleidete Frau in den Raum, die sie für die Sekretärin hielt. Es war Madame Curie persönlich. Marguerite erzählte später, dass sie froh war, das finstere Gebäude zu verlassen, überzeugt, dass sie den Job nicht bekommen würde. Sie irrte sich.
Angeleitet von Marie Curie lernte sie, radioaktive Elemente zu isolieren und zu reinigen. Sie arbeitete hauptsächlich mit Actinium, das André-Louis Debierne 1899 entdeckt hatte. Curie interessierte sich besonders für die Zerfallsreihe des Actiniums und so wurde Perey mit der komplexen Chemie dieses Elements vertraut. Nach Marie Curies Tod 1934, nur fünf Jahre nach Beginn der Zusammenarbeit, wurde die junge Assistentin unter dem neuen Institutsleiter Debierne zur Radiochemikerin befördert. Sowohl Debierne als auch Irène Juliot-Curie beauftragten sie, weiterhin angereichertes Actinium herzustellen. Joliot-Curie wollte dessen Halbwertszeit bestimmen, während Debierne nach „Neo-Radioelementen“ suchte, mit denen er vermutlich langlebige Isotope von Radium und Actinium meinte.
1935 las Perey eine Publikation von D. E. Hull, Willard Frank Libby und Wendell Mitchell Latimer, die sie stutzig machte. Die Amerikaner berichteten, dass sie die Beta-Strahlung von Actinium gemessen hätten. Bis dahin war eine direkte Messung von radioaktiver Strahlung des Actiniums (Ordnungszahl 89) nicht gelungen. Man konnte nur indirekt auf einen Beta-Strahler schließen, weil Thorium (Ordnungszahl 90) als Zerfallsprodukt bekannt war. Perey bezweifelte jedoch aufgrund der von Hull angegebenen Energie der Beta-Strahlen, dass sie von Actinium stammten. Sie glaubte vielmehr, dass sie ein Tochter-Kern freigesetzt hatte, der durch einen Alpha-Zerfall entstand. Dieser wäre ein Isotop des lang gesuchten Elements, um das damals bekannte Periodensystems zu vervollständigen. Mendelejew hatte es als Eka-Cäsium bezeichnet, weil es in der ersten Hauptgruppe unter dem Cäsium liegen musste.
Über die Weihnachtsferien 1938 erstellte Marguerite Perey einen Arbeitsplan für die Messungen, die mit den damals verfügbaren Elektrometern und Geiger-Zählern viel Geschick erforderten. Sie bat Debierne, sie für drei Wochen freizustellen und versprach, die Arbeit einzustellen, wenn sie das neue Element bis dahin nicht gefunden hätte. 30 Jahre später erinnerte sie sich: „Nach anfänglicher Ablehnung willigte er widerwillig ein und erklärte, die Idee sei dumm und wäre zum Scheitern verurteilt.“ Perey machte sich unter Hochdruck an die Arbeit. Oft blieb sie bis 23 Uhr oder Mitternacht im Labor. Schon 15 Tage später hatte sie Eka-Cäsium nachgewiesen. Bei der nächsten Sitzung der Académie des Sciences, die nur zwei Tage später, am 9. Januar 1938 stattfand, berichtete Jean Perrin über die Entdeckung – obwohl er daran beträchtliche Zweifel hatte.
„Sie können sich kaum vorstellen, auf wie viele Schwierigkeiten ich im Laufe dieser Arbeit gestoßen bin. Das ist ganz normal, aber viele Hindernisse traten auch nach Abschluss des Projekts noch auf“, schrieb Perey rückblickend an ihren Mitarbeiter Jean-Pierre Adloff. „Außerdem war ich erst 29 Jahre alt und besaß nur das Äquivalent eines Bachelor-Abschlusses in Chemie.“ Zu den Neidern gehörte Debierne. Er sah sich in gleicher Weise an der Entdeckung von Eka-Cäsium beteiligt wie Perey.
Einen Namen erhielt das Element erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Perey hatte es zuerst „Catium“ nennen wollen, weil es als das schwerste natürlich vorkommende Alkali-Element am stärksten elektropositiv ist. Ihre Kollegen meinten jedoch, dies klinge im Englischen nach „cat“, weshalb Perey zu Ehren ihres Heimatlandes den Namen Francium wählte. So folgte sie ihrer Mentorin Marie Curie, die schon 1898 das Polonium nach ihrer Heimat benannt hatte.
Francium ist nach Astat das zweitseltenste Element auf der Erde. Es kommt in der Erdkruste als Spurenelement in Uranmineralen vor. Wegen seiner kurzen Halbwertszeit von nur etwa 22 Minuten gibt es auf der Erde zu jeder Zeit weniger als 30 Gramm natürliches Francium. Es ist ein Beta-Strahler, der zu Radium zerfällt.
Perey erhielt aufgrund ihrer Entdeckung ein Stipendium an der Sorbonne, damit sie ihren akademischen Abschluss nachholen konnte. 1946 promovierte sie in Physik mit einer Arbeit über das Francium. Danach kehrte sie an das Radium-Institut zurück, bis sie 1949 einen Ruf an die Université de Strasbourg erhielt, wo sie ein neues Institut für Radiochemie aufbaute – damals das erste außerhalb von Paris. Hier entwickelte sie ein ehrgeiziges Lehr- und Forschungsprogramm zur Radio- und Kernchemie. Das Institut wuchs schnell und wurde 1958 unter ihrer Leitung zum „Centre de Recherches Nucléaires“ erweitert. Von 1950 bis 1963 war Perey außerdem Mitglied der Atomgewichts-Kommission.
Wie schon das Ehepaar Curie die medizinische Anwendung radioaktiver Elemente untersucht hatte, hoffte Marguerite Perey sie zur Krebsdiagnose einsetzen zu können. Sie untersuchte dazu die Bindung radioaktiver Isotope an gesundes sowie an Krebsgewebe.
Tragischerweise hatte sich durch die jahrelange ungeschützte Arbeit im Labor Actinium in ihrem Skelett eingelagert. Wenn sie ein Labor betrat, schlugen die Strahlungsdetektoren aus. Bereits zu Beginn ihrer Zeit in Straßburg hatte sie starke Schmerzen; 1960 wurde Knochenkrebs diagnostiziert. Sie musste ihre wissenschaftliche Arbeit aufgeben und verbrachte die letzten Lebensjahre in einer Klinik in Nizza.
Kurz vor ihrem Tod schrieb sie an Adloff: „Auch wenn die Zeit nachdem ich das Francium entdeckt hatte, gewisse Ehren mit sich brachte, erlebte ich auch Momente der Tränen und der Enttäuschung, durch die niederträchtigen Züge des menschlichen Charakters […] Dennoch meine ich, dass Gott mich im Laufe eines schwierigen Lebens gnädig mit Verständnis für alle Unwägbarkeiten ausgestattet hat, […] und mir die Kraft gegeben hat, weiterzumachen, auch in Zeiten schwerer Krankheit.“
Sie starb am 13. Mai 1975 im Alter von 65 Jahren.
Quellen und weitere Informationen
- Veronique Greenwood, My Great-Great-Aunt Discovered Francium. And It Killed Her, The New York Times Magazine, 7. Dezember 2014 (hinter Bezahlschranke)
- Jean-Pierre Adloff und George B. Kauffman, Francium (Atomic Number 87), the Last Discovered Natural Element, The Chemical Educator 10, 387 (2005)
- Jean-Pierre Adloff und George B. Kauffman, Triumph over Prejudice: The Election of Radiochemist Marguerite Perey (1909–1975) to the French Académie des Sciences, The Chemical Educator 10, 395 (2005) (PDF)
- Jagoda Urban-Klaehn, Women in Nuclear History: Marguerite Perey (28. Juni 2024)
- Marguerite Perey (famousscientists.org)
- Perey, Marguerite (1909–1975), in: Women in World History: A Biographical Encyclopedia (2025)
AP