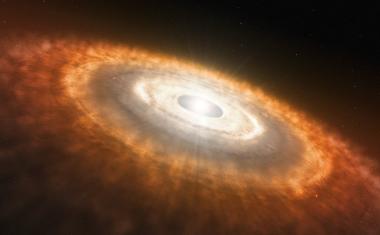Der Global Killer kam aus der Nachbarschaft
Reverse Engineering: Aus den „Zutaten“ des Einschlagskörpers lässt sich auf Theias Entstehungsort schließen. Dieser liegt im inneren Sonnensystem, wahrscheinlich sonnennäher als der der Erde.
Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren kam es zu dem wohl folgenreichsten Ereignis in der Geschichte unseres Planeten: Ein gewaltiger Himmelskörper, genannt Theia, schlug in die junge Erde ein. Wie sich der Zusammenstoß abspielte und was genau danach geschah, ist nicht endgültig geklärt. Sicher ist jedoch, dass sich als Folge Größe, Aufbau, Zusammensetzung und Umlaufbahn der Erde veränderten – und dass der Einschlag die Geburtsstunde unseres ständigen Begleiters im All, des Mondes, war.
![Künstlerische Darstellung des Zusammenstoßes der frühen Erde mit Theia. Da Theia aus dem inneren Sonnensystem stammt, ist in dieser Perspektive im Hintergrund die Sonne zu sehen.
[weniger]
© MPS / Mark A. Garlick](/media/story_section_text/60747/sml-01-1763460937-theia-impact-mps-magarlick.jpg)
Was war das für ein Körper, der den Werdegang unseres Planeten so dramatisch umschrieb? Wie groß war Theia? Aus welchem Material bestand sie? Und aus welchem Teil des Sonnensystems raste sie auf die Erde zu? Antworten auf solche Fragen zu finden, ist schwierig. Schließlich wurde Theia bei der Kollision vollständig zerstört. Dennoch finden sich noch heute Spuren von ihr, etwa in der Zusammensetzung der heutigen Erde und des Mondes. In der aktuellen Untersuchung schließen Forschende unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) und der Universität von Chicago auf diesem Wege auf die mögliche „Zutatenliste“ von Theia – und so auf ihren Entstehungsort.
Besonders aussagekräftig sind die Verhältnisse, in denen bestimmte Metallisotope in einem Körper vorliegen. Isotope sind Varianten desselben Elements, die sich allein durch die Anzahl ihrer Neutronen im Atomkern – und damit durch ihr Gewicht – unterscheiden. Im frühen Sonnensystem dürften die Isotope eines jeweiligen Elementes nicht gleichverteilt gewesen sein: Am äußeren Rand des Sonnensystems etwa kamen die Isotope in einem minimal anderen Verhältnis vor als in Sonnennähe. Informationen über die Herkunft seines ursprünglichen Baumaterials bleibt auf diese Weise in der Isotopenzusammensetzung eines Körpers gespeichert.
In der aktuellen Arbeit bestimmte das Forscherteam erstmals das Verhältnis verschiedener Eisenisotope in Erd- und Mondgestein mit bisher unerreichter Genauigkeit. Dafür untersuchen sie fünfzehn Proben typischen Erdgesteins und sechs Gesteinsproben, die Astronauten der Apollo-Missionen zurück zur Erde gebracht haben. Das Ergebnis überrascht kaum: Wie schon frühere Messungen der Isotopenverhältnisse von Chrom, Kalzium, Titan und Zirkonium ergeben hatten, sind Erde und Mond in dieser Hinsicht nicht unterscheidbar.
Doch die große Ähnlichkeit erlaubt keinen direkten Rückschluss auf Theia. Dafür sind zu viele Kollisionsszenarien denkbar. Zwar gehen die meisten Modelle davon aus, dass sich der Mond fast ausschließlich aus Material von Theia formte. Es ist aber auch möglich, dass er vornehmlich aus Material des frühen Erdmantels besteht oder dass sich das Gestein von Erde und Theia untrennbar durchmischte.
Um dennoch mehr über Theia zu erfahren, wandten die Forschenden eine Art Reverse Engineering für Planeten an. Ausgehend von den übereinstimmenden Isotopenverhältnissen in heutigem Erd- und Mondgestein spielten das Team durch, welche Zusammensetzungen und Größen von Theia sowie welche Zusammensetzung der frühen Erde zu diesem Endzustand geführt haben könnten. Die Forschenden schauten in ihren Untersuchungen nicht nur auf Eisenisotope, sondern auch auf solche von Chrom, Molybdän und Zirkonium. Die verschiedenen Elemente verschaffen Zugang zu unterschiedlichen Phasen der Planetenentstehung.
Lange vor der verheerenden Begegnung mit Theia hatte sich im Innern der frühen Erde eine Art Sortierprozess abgespielt. Mit Entstehung des Eisenkerns reicherten sich manche Elemente wie etwa Eisen oder Molybdän dort an; im Gesteinsmantel fehlten sie danach weitgehend. Das Eisen, das sich heute im Erdmantel findet, kann also erst nach der Kernbildung „zugereist“ sein, etwa an Bord von Theia. Andere Elemente wie Zirkonium, die nicht in den Kern sanken, dokumentieren hingegen die gesamte Entstehungsgeschichte unseres Planeten.
Von den rechnerisch möglichen Zusammensetzungen von Theia und der frühen Erde, die sich in den Berechnungen ergaben, scheiden einige als unplausibel aus. „Das überzeugendste Szenario ist, dass der Großteil des Baumaterials von Erde und Theia aus dem inneren Sonnensystem stammt. Erde und Theia dürften Nachbarn gewesen sein“, so MPS-Wissenschaftler Timo Hopp.
Während sich die Zusammensetzung der frühen Erde überwiegend als Mischung bekannter Meteoritenklassen darstellen lässt, ist dies bei Theia nicht der Fall. Verschiedene Meteoritenklassen sind in unterschiedlichen Bereichen des äußeren Sonnensystems entstanden. Sie dienen deshalb als Referenzmaterial für das Baumaterial, das bei der Entstehung der frühen Erde und von Theia zur Verfügung stand. Bei Theia dürfte auch eine größere Menge bisher unbekannten Materials im Spiel gewesen sein, dessen Ursprung die Forschenden näher an der Sonne verorten als die Erde. Die Rechnungen sprechen deshalb dafür, dass Theia sonnennäher entstanden ist als unser Planet. [MPS / dre]
Weitere Informationen
- Originalveröffentlichung
T. Hopp, N. Dauphas, M. Boyet, S. A. Jacobson, T. Kleine, The Moon-forming impactor Theia originated from the inner Solar System, Science, 390(6775), 819–823, 20. November 2025; DOI: 10.1126/science.ado0623 - AG Planetare Materialien (Christoph Burkhardt, Timo Hopp), Abteilung Planetare Materialien (Thorsten Kleine), Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Göttingen