
Ein Strahl wie mit 100.000 Laserpointern
Erneuter Laser-Weltrekord aus dem Ländle – Pikosekundenlaser mit 145 Watt Ausgangsleistung ermöglicht verbesserte Frequenzkonversion.

Erneuter Laser-Weltrekord aus dem Ländle – Pikosekundenlaser mit 145 Watt Ausgangsleistung ermöglicht verbesserte Frequenzkonversion.

PicoQuant und LZH entwickeln neue Laserquellen im BMBF-Verbundprojekt WhiSPER³.

Auszeichnung für Laserschweißregelung in Echtzeit: bessere Schweißverbindungen bei geringerem Energieeinsatz.

Neue Freiheitsgrade bei der optischen Datenübertragung durch Drehimpuls-Multiplexen.

Jenoptik präsentiert mikrooptische Homogenisierer aus CaF2 aus einem weiterentwickelten Herstellungsverfahren.

Löst Graphen bald Silizium als Basis für außerordentlich kleine und schnelle Transistoren ab?
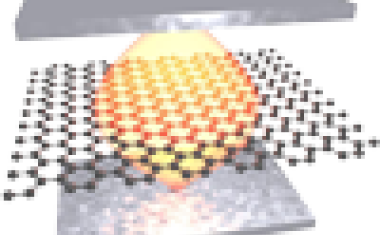
Optoelektronische Bauteile auf Basis von Graphen machen IT-Systeme langfristig kleiner und leistungsfähiger.

3. Conference on Biophotonics (ICOB) erstmals auf europäischem Boden – im Zeiss-Planetarium Jena.

Physiker Josef Bille in der Kategorie „Lebenswerk“ ausgezeichnet.

Brille mit bidirektionalen OLED-Mikrodisplays gewinnt den „Best in Show Award” zum 50. Jubiläum der Displaykonferenz SID 2012 in Boston.

LASYS zum dritten Mal bei der Messe Stuttgart, parallel zu den Stuttgarter Laser-Tagen SLT.

Neues Laserverfahren kann die Oberflächenstrukturierung organischer Solarzellen besonders schnell und effizient verbessern und dadurch den Wirkungsgrad erhöhen.

100.000 Euro für Forscher von der Oxford Universität.

Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF ist mit seinem Projekt „Optische Systeme mit Facettenaugentechnik“ im bundesweiten Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen" als „Ausgewählter Ort" ausgezeichnet worden.
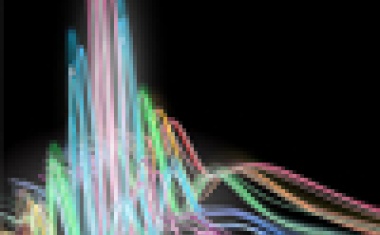
An der TU Wien gelang es einem internationalen Forschungsteam, langwellige Infrarot-Photonen in kurzwellige Röntgen-Photonen umzuwandeln.

Das Fraunhofer IWS Dresden stellt auf der LASYS in Stuttgart den Remote-Laserprozess für eine konturnahe, schnelle und flexible Endbearbeitung von TFP-Verbundstrukturen vor.

Präzisionsmessung am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE sichert Leistung von Solarmodulen.

Ergebnisse aus dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf zeigen erstmalig, dass Protonen für die Krebstherapie prinzipiell auch von einem Kurzpuls-Laser stammen können.
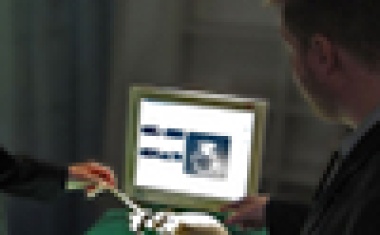
Verband Deutscher Vermessungsingenieure (VDV) verleiht Auszeichnung für ein Simulationsprogramm zur Bestimmung der Genauigkeit von Einkamerasystemen, die in der computerassistierten Chirurgie eingesetzt werden.

BMBF-Verbundprojekt OptiOxid erforscht neue Beschichtungstechnologien für Breitband-Laserspiegel.
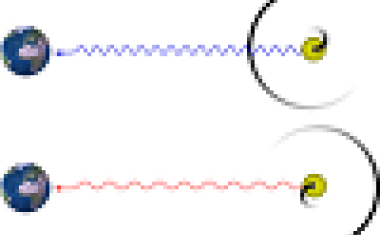
Laser-Frequenzkämme können jetzt als Kalibrationsquellen an astronomischen Spektrographen eingesetzt werden. Dies erleichtert die Suche nach extrasolaren Planeten, die einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems umkreisen.

Doppelte Systemhelligkeit dank neuer gruner LED-Komponente von Osram.

Forscher aus Berlin haben ein kompaktes Festkörperlasersystem für die minimalinvasive Chirurgie mit entwickelt, das Gehirngewebe mit einer bisher unerreichten Präzision schneiden kann.

Vom 9. bis 11. Mai 2012 trafen sich Experten der industriellen Lasertechnik in Aachen. Sie diskutierten die Bearbeitung neuer Materialien, Ultrakurzpulslaser und Laser Additive Manufacturing.

Physiker der Universität Innsbruck berichten über den Bau einer effizienten und frei justierbaren Schnittstelle für Quantennetzwerke.
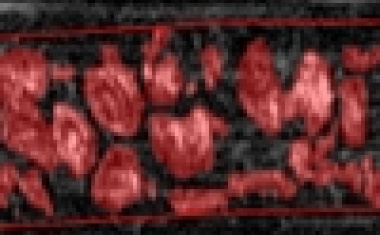
Neuentwicklung ermöglicht nichtinvasive in-vivo-Bestimmung wichtiger Blutwerte in Echtzeit.
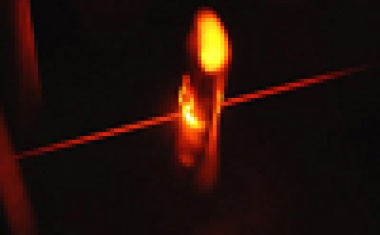
Die zwei jungen Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik (MPQ) zählen zu den Trägern des Wissenschaftspreises 2012, den der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft alle zwei Jahre vergibt.
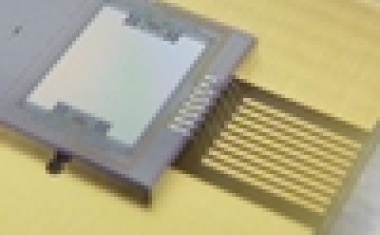
Ein Spektrometer, nicht größer als ein Stück Würfelzucker, soll Kunden künftig verraten, wie es um die Güte von Lebensmitteln bestellt ist.
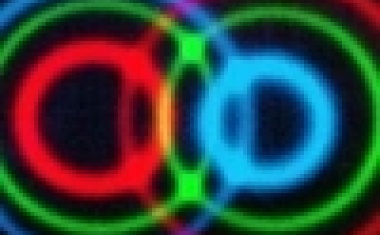
Erstmals ist es Forschern gelungen, einen durchstimmbaren phasensensitiven Photonenzähler mit 1,8 Millionen Parametern komplett zu beschreiben.
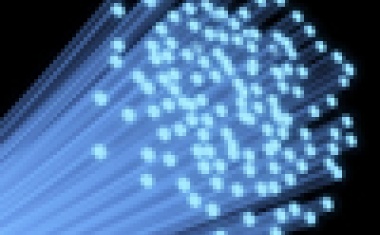
Der Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. stattet bis Ende 2012 sämtliche Glasfaserverbindungen im Wissenschaftsnetz X-WiN mit Multi-Terabit-Technologie aus.
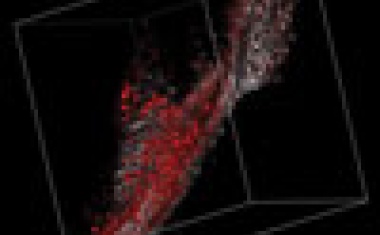
Konfokalmikroskope von Carl Zeiss erlauben jetzt die gleichzeitige Verwendung von zwei Lasern.
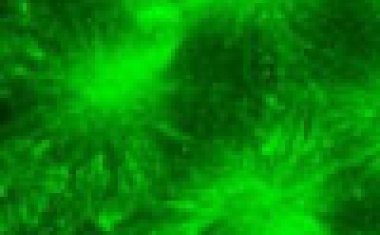
Neuartige Methode ermöglicht es, Zellstrukturen und -bewegung bei lebenden Tieren aufzulösen
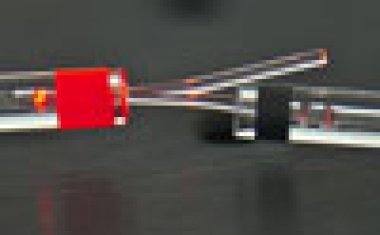
Lichtwellenleiter aus Kunststoff haben geringere Produktionskosten und sind eine günstige Alternative zu Glasfaserkabeln.

Ergebnis aus BMBF-Verbundprojekt: Laserbarren-Serie von Osram OS mit 200 Watt Dauerleistung.

Fraunhofer-Allianz „Vision“ stellt zerstörungsfreies Terahertz-Prüfsystem vor.