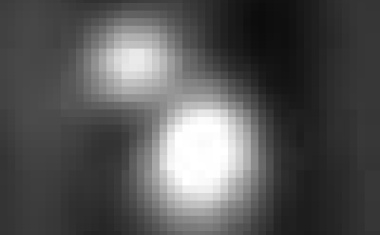
Molekül unter Kontrolle
Französischen Physikern gelang mit Hilfe eines Raster-Tunnelmikroskops das gezielte Umschalten zwischen zwei stabilen Molekül-Zuständen.
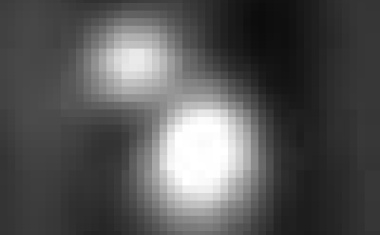
Französischen Physikern gelang mit Hilfe eines Raster-Tunnelmikroskops das gezielte Umschalten zwischen zwei stabilen Molekül-Zuständen.

Von Pfingstmontag an ist in Berlin die Ausstellung «Albert Einstein - Ingenieur des Universums» zu sehen.

Tropfen - z. B. die eines Kaffeefilters - gleiten häufig erst einige Sekunden auf dem Flüssigkeitsspiegel herum, bevor sie eintauchen. Warum eigentlich?

Wie sehen die optimalen Parameter für biomimetische Transportsysteme aus, die auf molekularen Motoren basieren?

Untersucht man skalenfreie Netzwerke, so erhält man Antworten auf sehr unterschiedliche Fragen, z. B. wie man am besten impft.
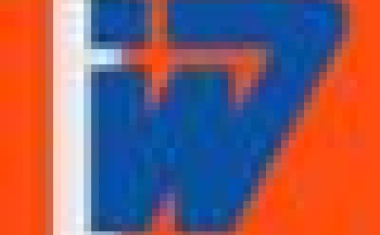
Nach einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln nimmt der Technikstandort Deutschland wieder Fahrt auf.

Aus Ärger über geplante Studiengebühren halten Studenten seit einer Woche das Rektorat der Freiburger Uni besetzt
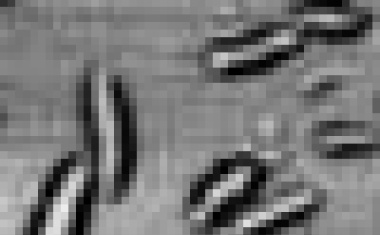
Freiburger Wissenschaftler haben Nanoröhrchen aus zyklischen Peptiden mit einem Bezug aus synthetischen Polymeren hergestellt.
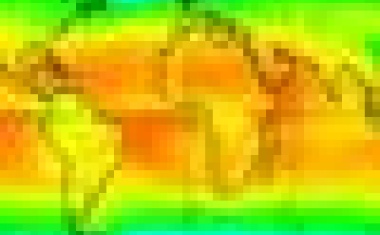
Wie viel Sonnenstrahlung erreicht die Oberfläche der Erde? Zwei unabhängige Forschungsgruppen sprechen von einer Zunahme seit 1990.

Vor 100 Jahren, am 11. Mai 1905, reichte Einstein das dritte Werk seines Wunderjahrs ein und erklärte die Brownsche Molekularbewegung.

Physik Journal - auf gewöhnlichem Zeitungspapier lassen sich organische Solarzellen aufbringen.

Im kommenden Jahr soll die NASA- und ESA-Mission «STEREO» gestartet werden, mit der die Sonne von zwei Satelliten aus erfasst wird.

Löst die Methanolwirtschaft das Energieproblem und kann sie gleichzeitig ein Ende der globalen Erwärmung einläuten?
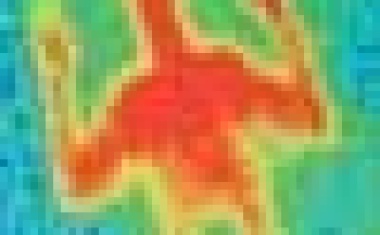
Physik Journal - Die vom Menschen ausgehende Terahertz-Strahlung lässt sich für Sicherheitschecks detektieren.

Astrophysiker finden bei massearmen Sternen Hinweise auf die Erzeugung des relativ seltenen Elements Fluor.

Vor 100 Jahren - am 30. April 1905 - schließt Albert Einstein seine Promotionsschrift ab. Den Gedanken daran hatte er bereits aufgegeben.

Kleine Erschütterungen der Erde geben offensichtlich Hinweise, an welchem Ort mit starken Erdbeben zu rechnen ist.

Ein pyroelektrischer Kristall lässt Deuteriumkerne verschmelzen.

Ein Material mit einzigartigen elektrischen Eigenschaften eignet sich für kleine Wasserstoffspeicher und -detektoren.
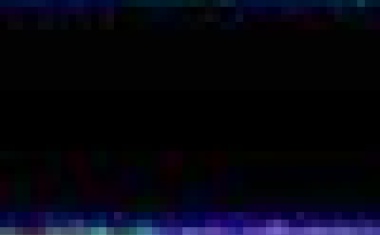
Eine internationale Forschergruppe stellt eine neue Methode zur Visualisierung ultrakurzer Prozesse vor.

Physik Journal – Photochromes Glas färbt sich automatisch stark ein, wenn es intensivem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

Eine dünne Silberschicht bildet Details weit unterhalb der Lichtwellenlänge ab.

Ein neues winziges Halbleiter-Element macht es möglich, den Kernspin auf der Nanometerskala zu kontrollieren und nachzuweisen.

Programme und Präsentationen sind gesucht, die die Faszination der Naturwissenschaften vermitteln.

Deutschlands Windenergiebranche will einen Test-Windpark auf dem Meer aufbauen. Der Start ist für 2007 geplant.
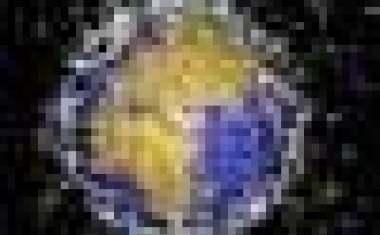
Außerhalb der Erdatmosphäre zieht Raketenschrott seine Bahnen und wird zur wachsenden Gefahr für die Raumfahrt.

Forscher der CAST-Kollaboration suchen am CERN nach einem theoretisch vorhergesagten, elektrisch neutralen Elementarteilchen, dem Axion.

Allein mit Laserlicht lässt sich ein spezielles Fluoridglas auf frostige minus 65 Grad Celsius abkühlen.
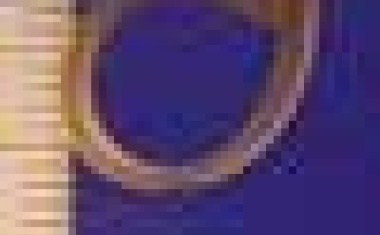
Ein neuartiger Gedächtnis-Kunststoff verformt sich auf Knopfdruck - ganz einfach durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht

Eine neue Terahertz-Strahlungsquelle umgeht alle Schwachstellen bisheriger Ansätze.

Der Bildschirm der Zukunft wird extrem flach, biegsam, selbstleuchtend, farbecht und kontrastreich sein - wenn organische Leuchtdioden (OLEDs) soweit sind.

Vom 11. bis 26. Juni findet in Potsdam und Berlin der Wissenschaftssommer 2005 statt. Dabei steht Albert Einstein im Mittelpunkt.
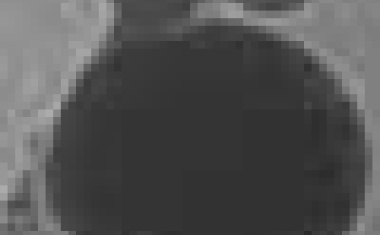
Forscher haben den bislang kleinsten Elektromotor der Welt gebaut - weniger als 0,2 tausendstel Millimeter ist eine Seite lang.
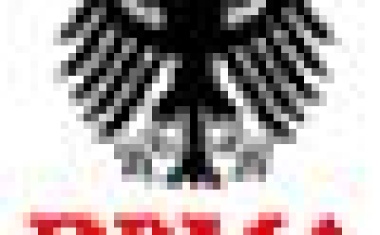
Deutsche Erfinder gehen in die Offensive: Erstmals seit fünf Jahren ist die Zahl deutscher Patentanmeldungen wieder angestiegen.
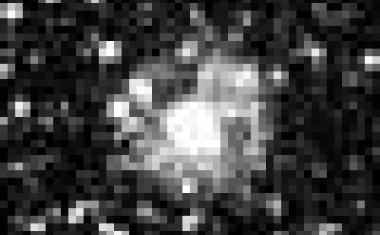
Sakurais Objekt - ein 1996 entdeckter Weißer Zwerg - blähte sich überraschend schnell zu einem Roten Riesen auf. Ein neues Modell kann dies erklären.