
Pauli-Verbot überprüft
Italiensche Forscher haben das Pauli-Verbot, eine der Grundsäulen der Physik, mit großer Genauigkeit überprüft.

Italiensche Forscher haben das Pauli-Verbot, eine der Grundsäulen der Physik, mit großer Genauigkeit überprüft.

Das Dauereis des Arktischen Ozeans rings um den Nordpol ist zwischen 2004 und 2005 plötzlich und rapide um 14 Prozent geschrumpft.

Das Astrophysikalische Institut Potsdam und das Forschungszentrum Rossendorf konnten erstmals in einem Laborexperiment die Magnetorotationsinstabilität (MRI) nachweisen.

RUB-Physiker analysieren und simulieren die "Freak Wave" - Neue Theorie zum Verhalten des Wassers auf hoher See.

Nach fast vierjähriger Wartezeit war es am Dienstag so weit: Der sehnsüchtig erwartete Ausbau der Internationalen Raumstation ISS ging endlich weiter.
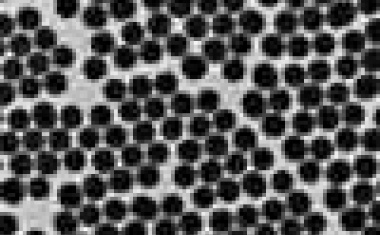
Welchen Einfluss hat die Oberfläche, wenn sich Kolloide zu einem zähflüssigen Gel zusammenlagern?

Der menschliche Einfluss auf das Klima ist offenbar mitverantwortlich für die Zunahme starker Tropenstürme.
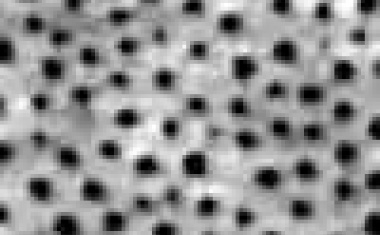
Siliciumdioxid-Nanokapseln lassen sich durch Aufschäumen von Polymeren mit überkritischem Kohlendioxid herstellen.
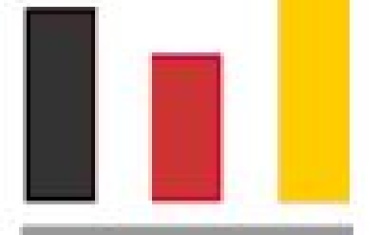
Der Anteil der Hochschulabsolventen pro Altersjahrgang ist zwischen 2000 und 2004 von 19,3 auf 20,6 Prozent leicht angestiegen.
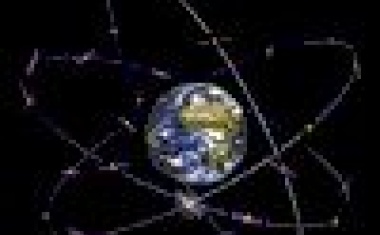
Das europäische Satelliten-Navigationsprojekt Galileo kommt nur langsam voran.

Auch in Planetensystemen mit "heißen Jupitern" kann es erdähnliche Planeten in der lebensfreundlichen Zone geben.

Der japanische Physiker Shuji Nakamura hat am Freitag in Helsinki den Millennium-Technologiepreis bekommen.

Freie-Elektronen-Laser bei DESY erreicht höchste Leistung bei kleinsten Wellenlängen und dringt ins Wasserfenster vor.

Turbulente Rohrströmungen werden irgendwann von selbst wieder laminar.

Eine neue Technik erhöht die Speicherkapazität der Speicherelementbausteine DRAM.

Erich Sackmann, Preisträger der Stern-Gerlach-Medaille, erläutert die mechanischen Kräfte, die für die Zelladhäsion entscheidend sind.
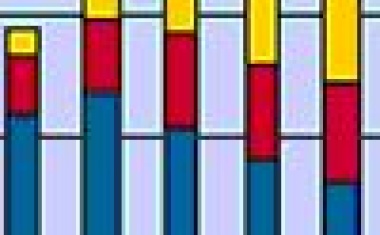
Physik ist weiterhin ein gefragtes Studienfach: Die Zahl der Studienanfänger hat gegenüber dem Vorjahr um knapp fünf Prozent auf 8.880 zugenommen.

Der Atomausstieg macht nach einer Studie von Ernst & Young in den kommenden 15 Jahren zusätzliche Milliarden-Investitionen der Energiekonzerne nötig.

Die ESA feiert die Forschungsreise der Sonde «SMART-1» als «vollen Erfolg».

Österreichs Physiker treffen sich in Graz zur Jahrestagung der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft.

Ein neues Material besitzt eine super-wasserabweisende Eigenschaft, die sich mit Licht an- und ausschalten lässt.

Physiker der Uni Augsburg ersetzen herkömmliche Halbleitermaterialien in Transistoren durch Oxide.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Wirtschaft ermahnt, mehr Geld in Forschung und Innovationen zu investieren.

Ein modifiziertes Beschichtungsverfahren verspricht Vorteile bei der Herstellung von Dünnschichtsolarzellen.

Auch Neutronensterne können bei einer Supernova Röntgenblitze ins All schleudern.

Durch kohärente Anregung lässt sich die Effizienz des Rhodopsins verbessern.

Die NASA hat dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Lockheed Martin den Zuschlag für den Bau einer neuen Raumfähre gegeben.

Die Ozonschicht erholt sich einer US-Studie zufolge nur langsam und vor allem in niedrigeren Lagen der Atmosphäre.

Die Raumfähre «Atlantis» soll nach mehreren Verzögerungen wegen Pannen und des Tropensturms «Ernesto» bald starten.

Seit Jahrzehnten hat sich am Nachweis magnetischer Kernspinresonanzen nichts Grundlegendes geändert. Ein neues optisches Verfahren soll mehr Informationen liefern.
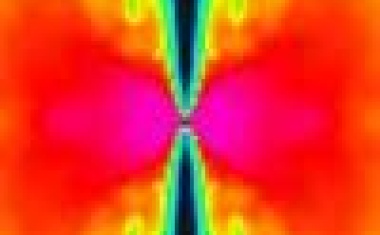
Ein internationales Astronomenteam hat einen Stern während der Explosion in einer Supernova beobachtet.

Durch die neue PAFATHERM-Technologie sollen zukünftige Fahrzeuge schneller, sicherer und sparsamer werden können.

Das «Hubble»-Weltraumteleskop hat ein detailreiches Bild der jüngsten bekannten Sternexplosion in der Milchstraße aufgenommen.
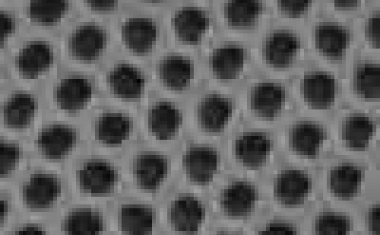
Mit Hilfe eines neuen Verfahrens können Wissenschaftler aus Halle Aluminium in kurzer Zeit mit einer strukturierten Oxidschicht überziehen.

Astronomen der Universität Jena fotografierten einen ungewöhnlichen Begleiter eines extrasolaren Planetensystems.