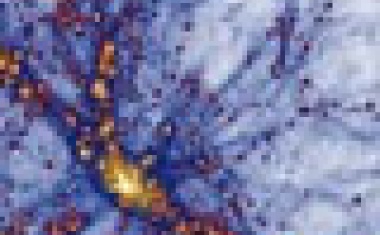
Mehr Licht im Falle der Dunklen Materie
Annalen-der-Physik-Sonderheft „Dark Matter“: Neueste Forschungsergebnisse zusammengefasst von Matthias Bartelmann und Volker Springel.
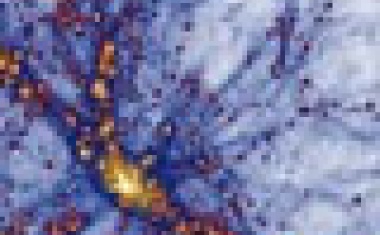
Annalen-der-Physik-Sonderheft „Dark Matter“: Neueste Forschungsergebnisse zusammengefasst von Matthias Bartelmann und Volker Springel.

Physiker vom Institut Laue-Langevin und der LMU München haben einen unerwartet hohen Brechungsindex bei Silizium gefunden.

Untersuchungen an einem Meteoriten zeigen: Asteroid hatte in seiner Frühgeschichte einen flüssigen, metallischen Kern.

Neue Methode ermöglicht gleichmäßiges Abkühlen – leichtere Analyse der Quantendynamik chemischer Reaktionen bei tiefen Temperaturen.

Neue Methode zur Erforschung und Simulation eines riesigen Magnetfelds, wie es sonst nur auf Neutronensternen herrscht.
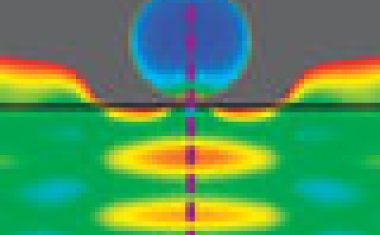
Neuartiger Dünnschichtsensor verspricht wesentlich größere Einsatzbreite als herkömmliche.
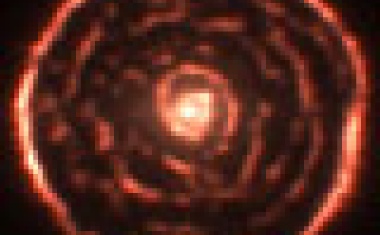
ALMA findet Spirale aus Gas und Staub um einen Sternsenior.

Kohlenstoffnanoröhrchen auf Supraleiter ergeben eine effiziente Quelle von Cooper-Paaren.
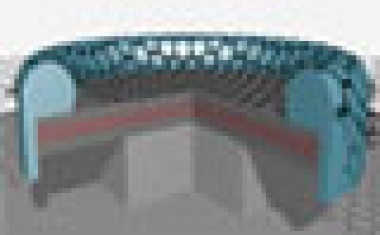
Ein Mikroscheibenlaser lässt sich durch eine Graphenelektrode äußerst effizient antreiben.

Die DPG gratuliert den beiden Nobelpreisträgern für Physik, Serge Haroche und David Wineland, beide Träger des gemeinsam mit der OSA vergebenen Herbert-Walther-Preises.
Feierliche Eröffnung an der TU Berlin mit Nobelpreisträger Gerhard Ertl und Staatssekretär Knut Nevermann.

Spektrales Multiplexing ermöglicht Bildrekonstruktion bei Einzelbelichtung im Femtosekundenbereich.

Den Physik-Nobelpreis 2012 teilen sich Serge Haroche und David Wineland „für die Entwicklung experimenteller Methoden, mit denen sich individuelle Quantensysteme messen und manipulieren lassen“.

Konfokales Laserrastermikroskop erweitert Analysemöglichkeiten am Geomar.

Lokale Wärmebehandlung von hochfesten Stählen ermöglicht eine räumlich begrenzte Entfestigung.
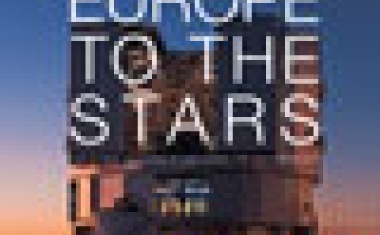
Am 5. Oktober 2012 feierte die Europäische Südsternwarte das 50-jährige Jubiläum der Unterzeichnung ihres Gründungsvertrags.

Wie sich die Wellenlänge einzelner Photonen mithilfe eines Kristalls gezielt verändern lässt, um Quantenkommunikation oder die sekundenschnelle Berechnung komplexer Probleme zu ermöglichen.
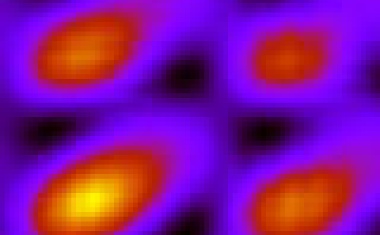
Grundlegende Unterschiede zum bereits gut erforschten Tunnelprozess einzelner Teilchen aufgedeckt.

Mit der Bewilligung von fast 180 Millionen Euro gab die Europäische Kommission grünes Licht für das rumänische Teilprojekt der Extreme Light Infrastructure.
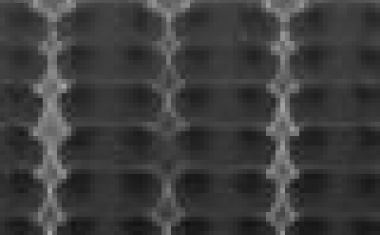
Neues Verfahren erzeugt mit zweidimensionaler Schablone dreidimensionale Mikrostrukturen, die sich für optische Telekommunikation eignen.
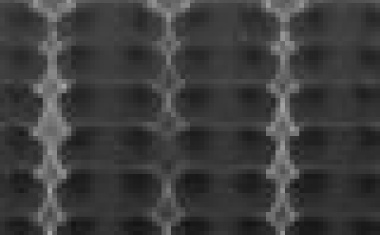
Neues Verfahren erzeugt mit zweidimensionaler Schablone dreidimensionale Mikrostrukturen, die sich für optische Telekommunikation eignen.

Mit Hilfe eines schnell gesteuerten Lichtschlauchs können Freiburger Forscher kleinste Einzeller festhalten und sichtbar machen.
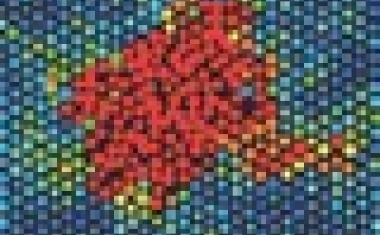
Überhitzte kristalline Kolloide zeigen ein unerwartetes Verhalten.

Am 9. Oktober um etwa 11.45 Uhr gibt die Nobelstiftung bekannt, wer in diesem Jahr den Physik-Nobelpreis erhält.
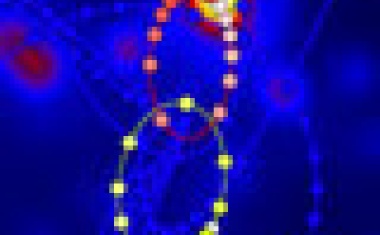
Mit einer Umlaufzeit von elfeinhalb Jahren kann der Stern bei der Überprüfung der Allgemeinen Relativitätstheorie helfen.

3D-Lasersintern metallischer Ausgangsstoffe erlaubt eine neue Art der Konstruktion.

Extreme mechanische Verspannung von Silizium verbessert die elektronischen Eigenschaften des Materials.
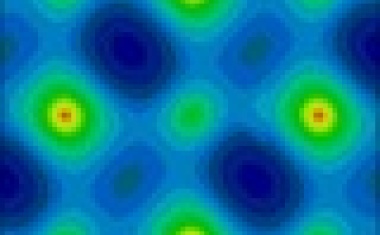
Röntgenbilder zeigen: Bei starken Feldern wechseln sie zwischen benachbarten Atomen.
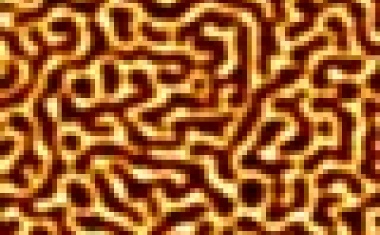
Freie-Elektronen-Laser FLASH zeigt überraschenden Effekt bei ferromagnetischen Stoffen.
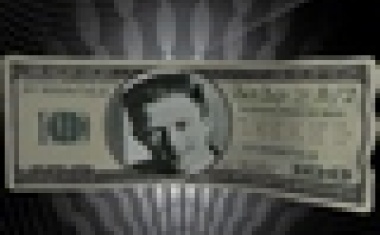
Fehlertolerante und fälschungssichere Quantengutscheine könnten das Zahlungsmittel der Zukunft sein.

Mit Laserpulsen ausgerichtet und mit Elektronen abgelichtet.

Forscher realisieren Photo-Stromerzeugung mit einzelnem Proteinkomplex.

KIT entwickelt Pilotsysteme aus Wind- und Solaranlagen gekoppelt mit Lithium-Ionen-Batterien.

Neue Hornhäute eignen sich für Menschen, die keine Spenderhornhaut erhalten oder vertragen.
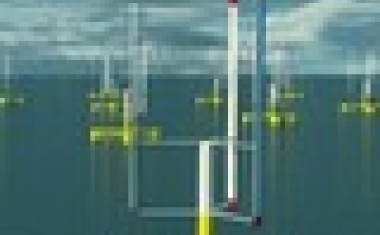
Internationales Konsortium verständigt sich über Demonstrationsprojekt zu multiplen schwimmenden Vertikalachsen-Windenergieturbinen.