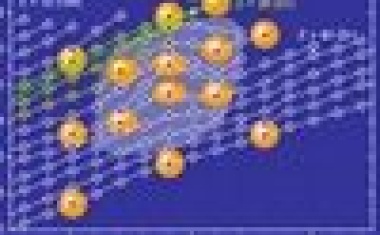
Kernmaterie am kritischen Punkt
Neue Ergebnisse für die Masse zweier Krypton-Isotope ergeben eine bessere Abgrenzung für Quanten-Phasenübergänge in Atomkernen.
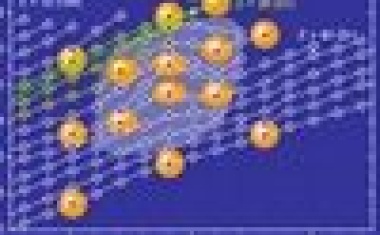
Neue Ergebnisse für die Masse zweier Krypton-Isotope ergeben eine bessere Abgrenzung für Quanten-Phasenübergänge in Atomkernen.

Mosaiktechnik ermöglicht die laut NASA genaueste globale Karte des Mars.

Die Quantentheorie muss vorerst nicht modifiziert werden, wie Beugungsexperimente mit Laserlicht an einem Dreifachspalt ergeben haben.

Erste umfassende Studie zu Erfolgsfaktoren veröffentlicht.

Der Begleiter der Erde ist immer noch für Überraschungen gut: Forscher finden bei neuer Untersuchung unerwartet viel flüchtige Stoffe in einer Gesteinsprobe von Apollo 14.

Dualspeicher aus Batterie und Kondensator und eine elektrisch geschaltete Kupplung gehören zu den ersten Ergebnissen des Großprojektes "Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität".

Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik feiert 50-jähriges Jubiläum.

Besatzung der Internationalen Raumstation repariert Sauerstoff-Generator und entgeht Kollision mit Weltraum-Schrott.

Ort und Impuls lassen sich besser vorhersagen als es von Heisenbergs Unschärferelation zu erwarten wäre, wenn der Empfänger einen Quantenspeicher zu Hilfe nimmt.

Die genaue Bestimmung der Polarisierbarkeit von Neon hilft, theoretische Modelle zu überprüfen.

Hubble-Teleskop beobacht einen mit hoher Geschwindigkeit flüchtenden, blauen Riesenstern am Rand unserer Galaxie.

Wissenschaftsfestival zur Energieforschung in der Innenstadt.

Mit einer einfachen chemischen Methode ist es erstmals gelungen, wenige Nanometer breite Bänder aus Graphen auf Oberflächen wachsen zu lassen.

Das Röhrenkonzept von Polymeren soll fundiert werden.

Nur einen Monat nach dem Start des Zwillingssatelliten gelang erstmals die Erstellung eines digitalen Höhenmodells der Erde aus dem All.

Weit schwerer als bislang angenommen: Astronomen entdecken Sterne mit 300 Sonnenmassen.

Materialwissenschaftler entdecken neuen Mechanismus der Glasbildung.

Deutscher Fachverband IVAM erwartet Aufschwung in den Branchen Mikrotechnik, Nanotechnik und Neue Materialien.

Die Europäische Raumfahrtagentur warnt auf dem Bremer Weltraumforscherkongress COSPAR vor einer wachsenden Gefahr für Satelliten.

Einen mp3-Player hat heute fast jeder - dass der Standard in Erlangen entwickelt wurde, wissen hingegen nur wenige. Am 20. Juli 2010 feiern die Fraunhofer-Institute IIS und IISB ihr Jubiläum.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt eröffnet "Earth Observation Center" bei München.

Ein neues Material soll bei der Suche nach einem permanenten elektrischen Dipolmoment helfen.

Beobachtungen des Weltraumobservatoriums Herschel deuten auf einen Aufprall vor einigen hundert Jahren hin.

Über Elektrodeposition lassen sich um ein Vielfaches kleinere Kontakte auf Computerplatinen knüpfen.

Seit Dezember 2009 umkreist "WISE" die Erde über die Pole hinweg.

An Molekülen auf einer Silberoberfläche konnte erstmals inverses Schmelzen in zwei Dimensionen beobachtet werden.

Elektronen in topologischen Oberflächenzuständen lassen sich weder von Störstellen noch von Stufen in einer Kristalloberfläche aufhalten.

Ein Blick in die Erdgeschichte offenbart Geologen ökonomisches Potential.

Ein beim Kollaps eines massereichen Sterns entstandener Strahlenausbruch legte am 21. Juni "Swift" lahm.

Astronomen enthüllen mit interferometrischen Beobachtungen die geheimnisvolle Geburt massereicher Sonnen.

Forscher beobachten atomare Vorgänge beim Dotieren von Halbleitermaterialien.

Die Bundesforschungsministerin will die Innovationspolitik der Bundesregierung an konkreten Zielen ausrichten.

Die NASA und Microsoft veröffentlichen online die größte nahtlose 3D-Karte des Sternenhimmels.

Der Durchmesser des Protons ist erheblich kleiner als bisher angenommen. Das haben Experimente mit myonischem Wasserstoff am Paul Scherrer Institut ergeben.

Forscher erwarten deutliche Verbesserung des Wirkungsgrads bei CIGS-Dünnfilm-Solarzellen.