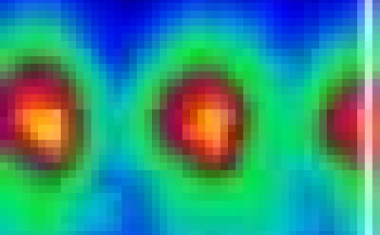
Ultraschnelle Quanten-Teilchen
Heidelberger Kernphysiker "filmen" und beeinflussen das Zerbrechen von Wasserstoffmolekülen.
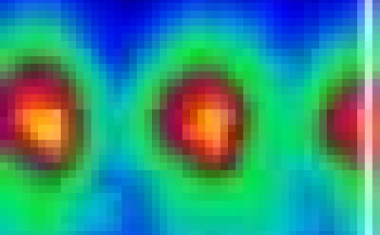
Heidelberger Kernphysiker "filmen" und beeinflussen das Zerbrechen von Wasserstoffmolekülen.

Physik Journal - dank zweier neuer farbkonvertierender Phosphore lässt sich mit einer blauen Leuchtdiode angenehm weißes Licht erzeugen.

Bund und Industrie haben zusammen mit der staatlichen KfW Bankengruppe den «High-Tech-Gründerfonds» gestartet.

Elektrische Felder lassen dünne Wasserschichten schon bei Zimmertemperatur gefrieren.

Der innere Kern der Erde rotiert schneller als Erdmantel und Erdkruste.
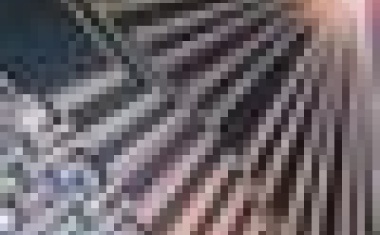
Marburger Physiker untersuchen die Dynamik von Spinströmen in Halbleitern.

Herbstbeginn am Firmament. Die Venus ist weiterhin Abendstern.
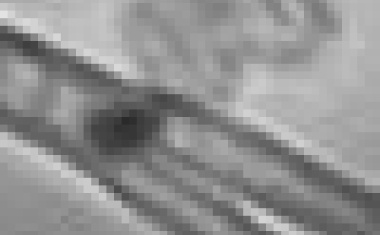
Amerikanische Physiker schafften es erstmals, Elektronen zuverlässig mit gegabelten Nanoröhrchen zu kontrollieren.

Nach Prognosen amerikanischer Astronomen wird ein Asteroid am 13. April 2029 nur haarscharf an der Erde vorbeischrammen.

Siemens hat den weltweit ersten Generator mit Hochtemperatur-Supraleitern in Betrieb gesetzt, der zukünftig Schiffe besonders energiesparend antreiben soll.
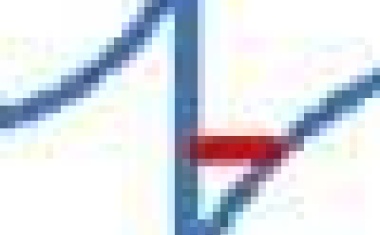
Mit Hilfe einer "ballistischen Methode" lassen sich einzelne Bits eines magnetischen Speicherchips (MRAMs) gezielter und damit schneller als bisher ansteuern.

Erstmalig konnte die Anzahl der Ladungsträger eines nichtmagnetischen Metalls durch das Anlegen eines starken Magnetfeldes geändert werden.

Ein Team amerikanischer und französischer Astronomen hat erstmals einen zweiten Mond bei einem Asteroiden aufgespürt.

Seit 2001 erhalten deutsche Studenten vom 3. Semester an auch in EU-Ländern Bafög. Eine Studie zur Förderpraxis vergab gute Noten.

Eine neue Software von Siemens sorgt im Laborversuch für ein Drittel mehr an Netzkapazität.

Der CASSINI-Staubdetektor enthüllt, wie Saturns so genannter E-Ring mit Mikrometeoriten gespeist wird.

Deutschlands Studenten sind unzufrieden mit der Politik. Studiengebühren und BAföG treibt sie auf die Straßen.
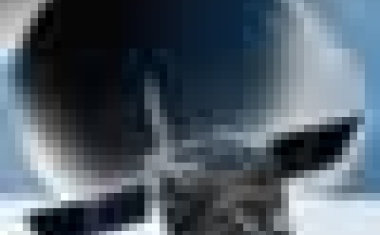
Erstmals wollen Studenten aus 12 europäischen Ländern einen gemeinsam erbauten Satelliten ins All schießen.

Der Astronaut, der als erster Mensch die Mondoberfläche betrat, feiert am 5. August 2005 seinen 75. Geburtstag.

Israelischen Wissenschaftler gelang es, den Stromfluss durch einzelne, organische Moleküle zuverlässig zu messen.

Das Geschäft in Asien und den USA läuft für den Spezialpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum hervorragend.
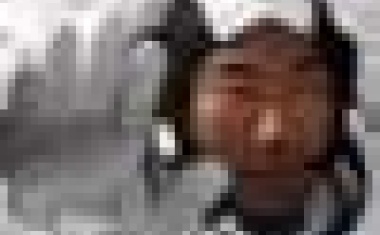
Die Discovery-Mission wird zum Weltraum-Abenteuer. Eine bisher einmalige Reparatur ist offenbar notwendig.

Wie deutsche Physiker 1945 forschten, um eine "Uran-Kraftmaschine" zu entwickeln.
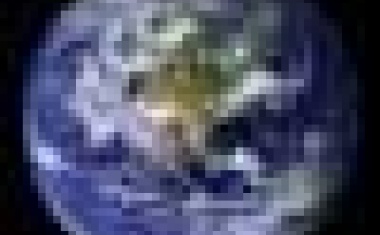
Wegen der Erdneigung war es vor 125.000 Jahren bis zu 2 Grad wärmer als heute.

Wissensdurstige Jugendliche können sich von sofort an für die neue Runde von 'Jugend forscht' anmelden.
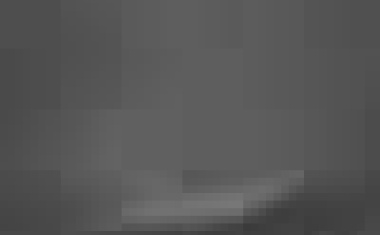
Eine Analyse von Staub in der Mars-Atmosphäre lässt darauf schließen, dass der rote Planet schon seit langem trocken und kalt ist.
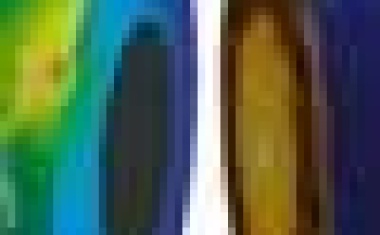
Antineutrinos liefern den Beweis für eine radioaktive Aufheizung des Erdinneren.
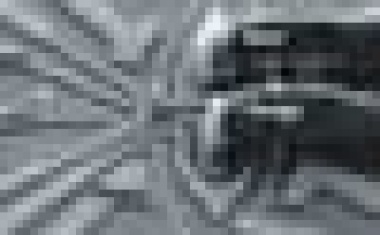
Forscher in Israel haben gemessen, wie sich die Phase eines Elektrons beim Durchqueren eines Quantenpunkts ändert.
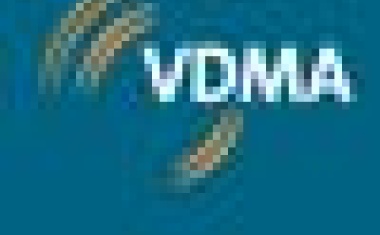
Nach dem Boom-Jahr 2004 ist bei den deutschen Maschinenbauern die Euphorie verflogen.

Mit Einbruch der Dunkelheit tauchen die Planeten Venus und Jupiter als erste am westlichen Firmament auf.

Physik Journal - Mit LEDs könnten sich Flüssigkristall-Bildschirme besser und energiesparender ausleuchten lassen.

Der schnellste Supercomputer Deutschlands steht in Stuttgart. Er ist 5000 Mal schneller als ein PC.

Mit Röntgenpulsen gelang es, den Wettlauf von Elektronen zwischen einem Schwefel- und einem Ruthenium-Atom zu messen.

Freistehende zweidimensionale Atomkristalle lassen sich einfach herstellen und sind überraschend stabil.

Rund 810 000 Schüler und Studenten erhielten 2004 Geld nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).