
Simulations-Software optimiert organische Leuchtdioden
Durch Simulation molekularer Prozesse lassen sich maßgeschneiderte OLED schneller und kostengünstiger designen.

Durch Simulation molekularer Prozesse lassen sich maßgeschneiderte OLED schneller und kostengünstiger designen.

Mit nur einem einzigen Laserstrahl lassen sich bis zu 700 DVDs pro Sekunde übertragen.
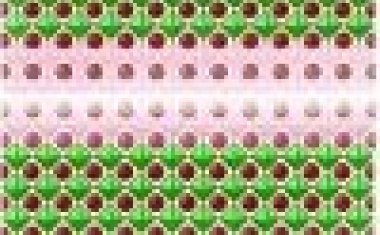
Die elektronischen und magnetischen Eigenschaften dünner Schichten eines Metalloxids hängen von der Zahl der übereinander gestapelten Atomlagen ab.

Mit einem weltumspannenden Netzwerk von Teleskopen lassen sich Strukturen in den Jets des nächstgelegenen schwarzen Loches erkennen.

Die Saturnatmosphäre gerät selten durcheinander. Dieses Mal schauen Cassini und das VLT genauerer hin.

Materialforscher wollen mit neuen Kupfer-Werkstoffen über lange Zeiträume gefährliche Keime abtöten.

Ozeanographen weisen Einfluss von äquatorialen Tiefenströmungen auf Niederschläge in Afrika nach.

Der Gravitationslinseneffekt enttarnt eine Reihe von Planeten weitab möglicher Sonnensysteme, aus denen sie entsprungen sein könnten.

Pläne für das europäische Gravitationswellenobservatorium der dritten Generation, das Einsteinteleskop, werden vorgestellt.

Inhomogene photonische Gitter aus Wellenleitern lassen Lichtwellen ohne Reflexionen durch.
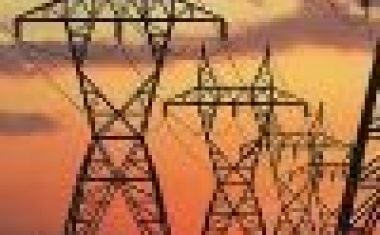
Ministerien stellen 200 Millionen Euro für Forschungsvorhaben zur Entwicklung von Speichertechnologien bereit.

Die Wasserbeständigkeit von Gläsern kann durch Einlagerungen von Metalloxiden in die Oberfläche erhöht werden.

Neues Forschungslabor in der Schweiz schirmt Erschütterungen, elektromagnetische Felder und Lärm hocheffizient ab – ideale Voraussetzungen für Nano- und Quantenforscher.

Zwischen 10 und 20 % des gesamten im Ozean gelösten Eisens und Kupfers sind hydrothermalen Ursprungs.

Forscher haben das Fließverhalten von Schlangengiften untersucht, die über eine Furche im Zahn in die Wunde gelangen.
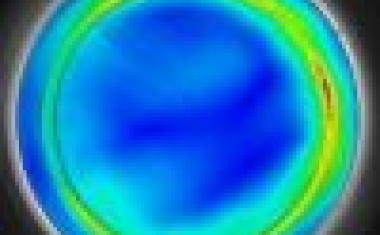
(a) Whispering gallery mode im Ringresonator (b) Verspannungen in Glas (c) Simulation einer Gravitationslinse

Trotz permanenter Tag- und Nachtseite kann der Planet Gliese 581d ein stabiles Klima haben und wäre damit der erste entdeckte habitable Exoplanet.
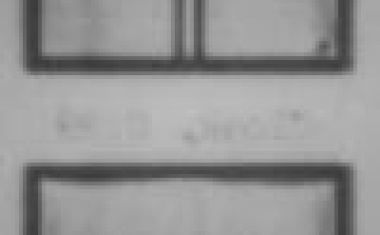
Demonstration einer Tarnkappe für sichtbares, rotes Licht.
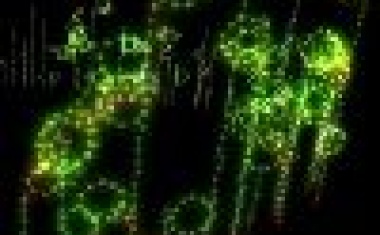
Neue Analyse könnte zu stabileren Stromnetzen, effizienteren Arznei-Therapien und Marketingkampagnen führen.

Aufgrund ihrer elektrischen Leitfähigkeit lenkt die Magmaschicht des Jupitermondes Ios das Magnetfeld des Planeten ab.

Durch Ummantelung mit einer Siliziumdioxid-Schicht lässt sich die Abgabe toxischer Silberionen unterbinden.

Warum einige sonnennahe Planeten ihr Zentralgestirn in der verkehrten Richtung umlaufen.

Französischer Wissenschaftspreis an Bochumer Festkörperphysiker verliehen.

Künstliche Ising-Spinkette findet ihren Quantengrundzustand von selbst.

Graphen ermöglicht schnelle und kompakte optische Modulatoren für die Kommunikations- und Rechentechnik.

Eine Studie zeigt, dass Direct Air Capture derzeit nicht geeignet ist, um den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu senken.

Sensorsystem, das Bewegungen frei im Raum detektiert, erleichtert die Steuerung von Industrierobotern.

Deutsch-chinesisches Raumfahrt-Projekt besteht Generalprobe.

Herschel weist Stürme nach, die Galaxien vom Rohmaterial für die Sternentstehung befreien.
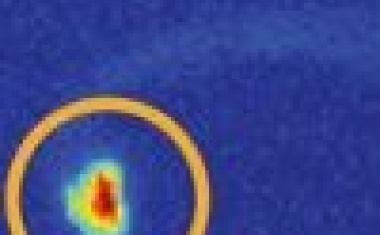
Durch elektrische Felder alleine können Elektronen wie in einem Wellenleiter geführt werden.
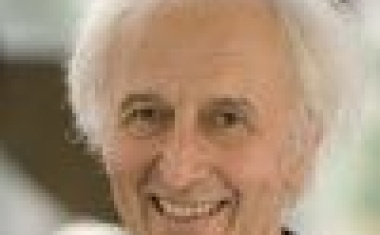
Präsident der Humboldt-Stiftung warnt vor fantasieloser Mainstreamforschung.

Ein Netzwerk von Überwachungsstationen soll kartieren, wo Kohlenstoff emittiert wird und wo sich Senken befinden.

Heidelberger Teilchenphysikerin Johanna Stachel wird erste Frau an der Spitze der DPG.
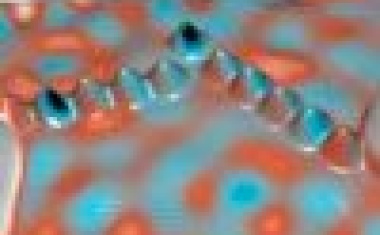
Ein logisches Oder-Gatter schaltet dank Nano-Spintronik ohne Stromfluss.

Der NASA-Satellit "Gravity Probe B" konnte die Gültigkeit zweier zentraler Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie mit hoher Genauigkeit nachweisen.