
Siliziumchips für optische Computer
Mit integrierten Hybridlasern erreichen photonische Siliziumchips 50 Gigabit pro Sekunde.

Mit integrierten Hybridlasern erreichen photonische Siliziumchips 50 Gigabit pro Sekunde.

Experimente bestätigen eine Theorie, wonach schwerer Wasserstoff bei tiefen Temperaturen schneller durch feinporige molekulare Siebe kommt.

Das Kepler-Teleskop der NASA entdeckt ein bemerkenswertes Planetensystem in unserer Galaxie.

In Japan und Italien konkretisieren sich Pläne für neue Teilchenbeschleuniger.

Forscher haben in einem Quantengraben Tri-Exzitonen, bestehend aus drei Elektron-Loch-Paaren, angeregt - aber keine Vier-Exzitonen-Zustände gefunden.
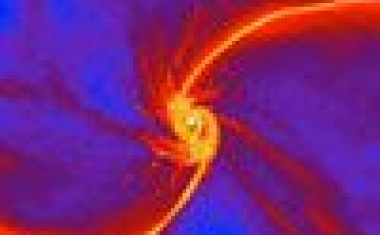
Schon weniger als eine Milliarde Jahre nach dem Urknall gab es Schwarze Löcher mit der milliardenfachen Masse der Sonne - Computersimulationen zeigen nun, wie diese Objekte so schnell entstehen konnten.
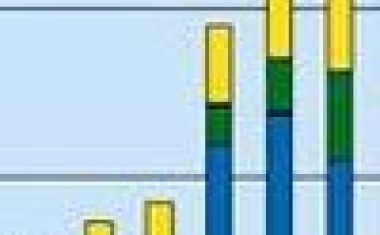
Aktuelle Zahlen über Neuzugänge und Abschlüsse.
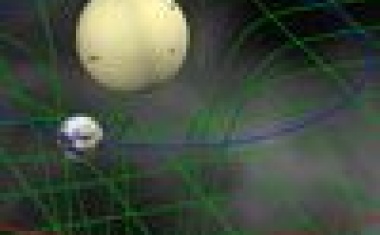
Zeitreihenmessungen von Pulsaren eröffnen einen neuen Weg, um Planetenmassen im Sonnensystem zu bestimmen.

Kurzinterview mit Günther Tränkle, Direktor des Ferdinand-Braun-Instituts, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik.

Ein billiger und prozesskompatibler RFID-Tag erleichtert die Klassifizierung von Baumstämmen.

Simulationen helfen bei der Untersuchung protonierter Wassercluster mittels Infrarotspektroskopie.

Eine besonders effiziente Erscheinungsform optischer Resonatoren könnte beim Nachweis von Gefahrenstoffen nützlich sein.

Die größte bisher entdeckte Planetenfamilie ähnelt unserem Sonnensystem.

Die EU will mit einer Richtlinie Personen schützen, die bei ihrem Beruf elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind.
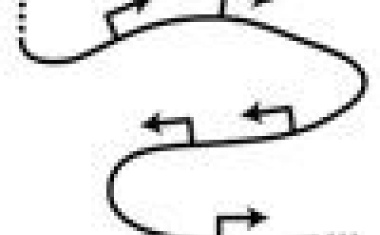
Physikalisches Modell analysiert die Verteilung der Nukleosomen.

Natürlicher Frostschutz: Anti-Freeze-Protein beeinflusst die Bewegung umgebender Wassermoleküle.
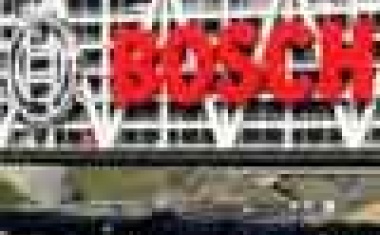
Neue eröffnete Fabrik in Thüringen soll pro Jahr 90 Millionen Zellen für Solaranlagen produzieren.

Ein THz-Quantenkaskadenlaser erreicht eine bessere Strahlqualität, wenn seine Oberfläche mit kleinen Furchen strukturiert wird.

Zellmembranen können zu Nano-Fließbändern werden.

Der Radius des Erdtrabanten ist in den letzten eine Milliarde Jahren um rund 100 Meter kleiner geworden.

Mit einem neuen Verfahren der Rastertunnelmikroskopie können Atomstrukturen im Inneren von organischen Molekülen wesentlich deutlicher dargestellt werden.

Computersimulationen zeigen erstmals, wie die Materie-Jets supermassiver Schwarzer Löcher miteinander verschmelzen.

Photoinduzierte Elektron-Loch-Paare werden von einer molekularen Monolage auseinander gerissen, sodass die Quanteneffizienz der Solarzelle nahezu 100 % erreicht.

Wie ultrakalte Atome in einem Lichtgitter einen Mott-Isolator bilden, haben Forscher in Garching jetzt atomgenau verfolgt.

Bundesregierung stellt der deutschen Solarindustrie 100 Millionen Euro für Forschungsprojekte zur Verfügung.

Astronomen beobachten einen Stern, der mit vierzigfacher Sonnenmasse zum Neutronenstern wird, und damit gängige Theorien in Frage stellt.

Geochemiker untersuchten junge Vulkangesteine des Laacher-See-Vulkans in der Eifel – Magmasystem ist vermutlich noch aktiv.

Robuste Folien aus künstlichen Perlmutt-Analoga wirken als Hitzeschild.

Signale lassen sich nach dem Zufallsprinzip ohne zusätzliches Rauschen verstärken.

Mathematiker entwickeln ein neues Modell zur Verbreitung bioaktiver Substanzen in Lebewesen.
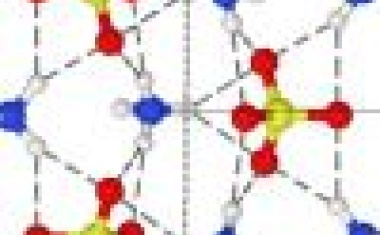
Forscher messen die Position von Elektronen und Protonen während einer chemischen Reaktion direkt mit ultrakurzen Röntgenblitzen.

Eine Kolonne von Putzrobotern, moderne Kunst oder doch etwas ganz anderes?

Hauptsitz der Weltvereinigung der Mathematiker kommt in die deutsche Hauptstadt.

Hobbyforscher stoßen im Rahmen des Projekts Einstein@Home in den Daten des Arecibo-Radioteleskops auf bislang unbekannten Neutronenstern.

Ein Forscherteam stellt eine Verbindung zwischen der Helligkeitsveränderung und hochenergetischer Gammastrahlung bei einem Novaausbruch her.