
Wirbelsturmbilder vom Jupiter
Bilder der NASA-Raumsonde "New Horizons" geben den bislang besten Einblick in einen gigantischen Wirbelsturm auf dem Planeten Jupiter.

Bilder der NASA-Raumsonde "New Horizons" geben den bislang besten Einblick in einen gigantischen Wirbelsturm auf dem Planeten Jupiter.

Heidelberger Wissenschaftlern gelingt in Zusammenarbeit mit dem DESY in Hamburg eine äußerst präzise Strukturuntersuchung an hochgeladenen Ionen.

Ein titandioxidhaltiges Verbundmaterial mit Perlmutt-Struktur ist härter als reines Titandioxid.

Mit einer neuen Methode können Navigationsgeräte den Weg um das 100fache schneller berechnen als bisher.

Das Eis am Nordpol schmilzt einer neuen Untersuchung zufolge drei Mal schneller als bisher vorhergesagt.

Der weltweite Energieverbrauch wird nach Berechnungen der Vereinten Nationen (UN) in den kommenden 25 Jahren noch einmal um 50 Prozent ansteigen.

China wird nach Meinung des Solarexperten Eicke Weber in wenigen Jahren der weltweit größte Abnehmer von Solaranlagen sein.

Nach der Einführung von Studiengebühren in mehreren Bundesländern versuchen Unternehmen zunehmend, junge Talente auch während eines Studiums finanziell zu unterstützen.

Mit Dorothee Dzwonnek wird erstmals eine Frau Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Die Rettung der Erde vor den katastrophalen Folgen des Klimawandels steht in dieser Woche auf der Tagesordnung des UN-Klimarats in Thailand.

Der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 94 Jahren.
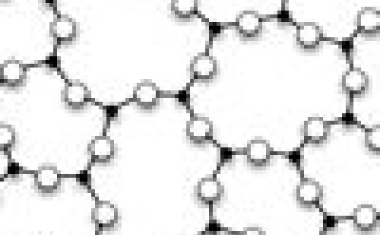
Forscher der Universität Leiden sind mit fluoreszierenden Molekülen dem Glasübergang auf der Spur.

Physik-Journal - Ein neues Verfahren erzeugt Implantate, in die sich Signalstoffe für das Zellwachstum einlagern lassen.

Der gelähmte britische Astrophysiker Stephen Hawking hat die Schwerelosigkeit erlebt. Er nahm an einem mehr als einstündigen Parabelflüg teil.

Der russische Präsident Wladimir Putin will die Forschung im Bereich Nanotechnologie mit umgerechnet fünf Milliarden Euro fördern.

Mit schwingenden Nanohebeln aus Silizium können amerikanische Forscher die Masse winziger Partikel in Flüssigkeiten aufs Femtogramm exakt bestimmen.
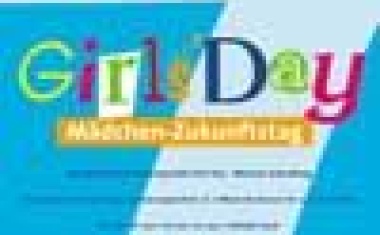
Rund 7500 Unternehmen beteiligen sich in diesem Jahr am bundesweiten «Girls' Day».

Astronomen haben nach eigenen Angaben den ersten bewohnbaren Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt.

Die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern haben den «Hochschulpakt 2020» gebilligt. Hamburg und Bremen enthielten sich der Stimme.

Das Satellit-Tandem «Stereo» der NASA hat die ersten dreidimensionalen Bilder der Sonne aufgenommen.

China wird nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur bereits in diesem Jahr die USA als größter Emittent von Treibhausgasen ablösen.

Der Helmholtz-Preis für Metrologie 2007 geht an den Physiker Göstar Klingelhöfer von der Universität Mainz.

Die Idee erscheint bestechend einfach. Das Klima schädigende Kohlendioxid wird im Kraftwerk aufgefangen und unter Tage gepumpt. Doch die Technik hat ihre Tücken.

Mit einem Rastertunnelmikroskop lässt sich auf atomarer Ebene beobachten, wie sich einzelne Moleküle gegenseitig erkennen.

Junge Frauen machen einer Umfrage zufolge heute die besseren Hochschulabschlüsse - verdienen aber schon beim ersten Job deutlich weniger als ihre männliche Kollegen.

Kurz nach Sonnenuntergang leuchtet halbhoch im Nordwesten ein heller Lichtpunkt auf - die Venus.

Forscher aus Ilmenau haben neue Wirbelstrukturen bei der Flüssigmetallströmung entdeckt.

Vor mehr als 30 Jahren wurde der Übergang des D-Mesons in sein Antiteilchen vorhergesagt. Kürzlich konnten Forscher diesen Effekt experimentell nachweisen.

Aus Rhenium und Bor lässt sich mithilfe eines relativ einfachen Verfahrens ein extrem harter Werkstoff herstellen.

Die optische und medizintechnische Industrie erwartet nach einem Rekordjahr 2006 weiterhin starkes Wachstum.

Das Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft ist in Kraft getreten.
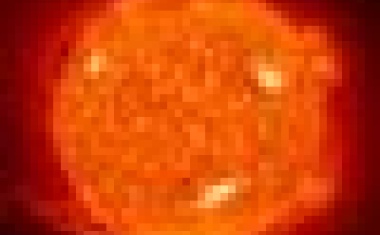
Die Sonne erzeugt eine Art himmlische Musik. Schleifen des solaren Magnetfelds verhalten sich nach Beobachtung von Astronomen ähnlich wie ein Instrument.

Anton Zeilinger und seine Mitarbeiter haben die nichtlokale Verschärfung der Bell'schen Ungleichung experimentell überprüft.

Für eine bessere Förderung von Innovation und Forschung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine umfassende Reform des europäischen Patentwesens gefordert.

Der Boom in der deutschen Windkraftbranche dauert an. 2006 stieg der Umsatz mit in Deutschland hergestellten Windkraftanlagen und deren Bauteilen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel.