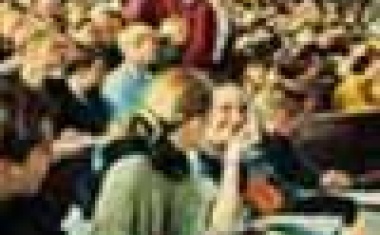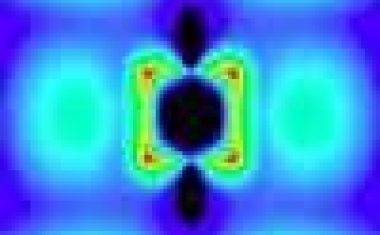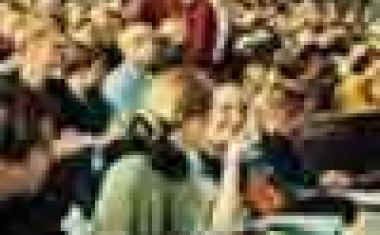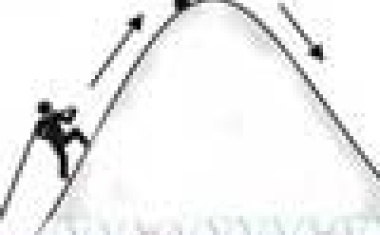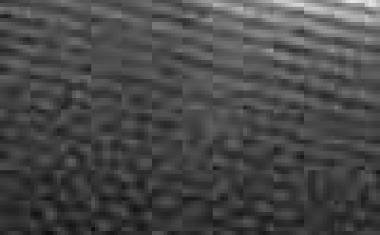«Europas Erfinder des Jahres»
Für ein Verfahren, das den Einbau von Airbags und anderen Sicherheitstechniken in Autos ermöglicht, sind Franz Lärmer und Andrea Urban von der Robert Bosch GmbH als «Europas Erfinder des Jahres 2007» ausgezeichnet worden.