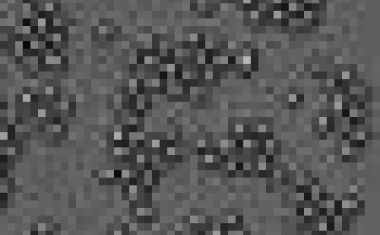
Glasperlenspiel mit Membranen
Mit Hilfe von winzigen Glaskugeln lassen sich Proteine sehr genau nachweisen: Anfangs vorhandene Kolloidkristalle lösen sich auf.
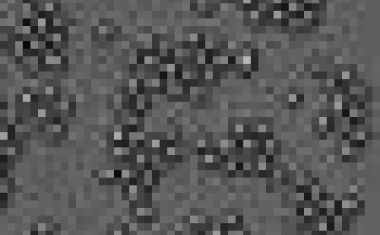
Mit Hilfe von winzigen Glaskugeln lassen sich Proteine sehr genau nachweisen: Anfangs vorhandene Kolloidkristalle lösen sich auf.
Eliteuniversitäten in Deutschland stoßen weiter auf ein kritisches Echo. Knapp die Hälfte der Deutschen befürwortet solche Spitzen-Hochschulen allerdings.

Die Marssonde «Spirit» sorgt weiter für Jubel: Der NASA-Roboter funkte das erste farbige Panoramabild zur Erde.

Die kostenlose DPG-Broschüre "Zukunftsmaschinen" ist in der 2. Auflage erschienen.
Physik Journal - Nutzer von Laptops träumen von immer leistungsfähigeren mobilen Stromquellen. Brennstoffzellen könnten Akkus ablösen.
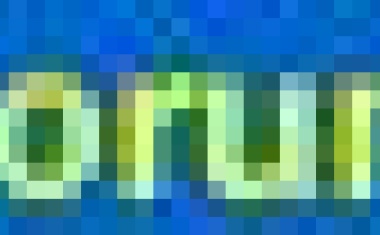
Die SPD plädiert für die Schaffung von Spitzenuniversitäten in Deutschland - Grüne fordern werteorientierte Politik. Diskutieren Sie in unserem Forum zu diesem Thema.

Der amerikanische Roboter «Spirit» ist am frühen Sonntag auf dem Mars gelandet.

Flache Kiesel hüpfen besonders gut übers Wasser, wenn sie unter einem magischen Winkel von 20 Grad auftreffen.

Es gibt Hinweise, dass in bestimmten Metallen ein bisher unbekannter Mechanismus an der Supraleitung beteiligt ist.
Nanoringe aus Cadmiumsulfit könnten sich dank Ihrer Photolumineszenz für optoelektronische Anwendungen eignen. (aus: Physik in unserer Zeit)
Erstmals ist es gelungen, eine Verletzung der Bellschen Ungleichung bei Elementarteilchen nachzuweisen. (aus: Physik in unserer Zeit)
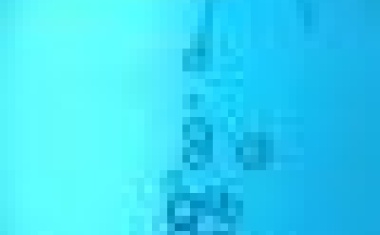
Nicht alle Blasen verhalten sich wie Sektperlen: So genannte Anti-Blasen sinken nach unten.

Atomlaser reagierten bislang empfindlich auf Magnetfelder. Ein neuer Atomlaser zeigt sich dagegen unbeeindruckt.

Mit deutscher Beteiligung wurde die bisher größte kosmische Gravitationslinse entdeckt.
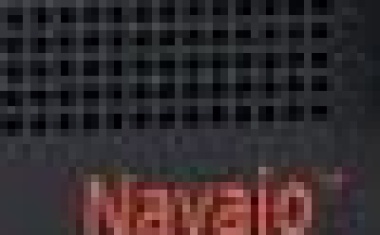
Physik Journal - Die ersten Codier-Geräte mit abhörsicherer Quanten-Kryptographie kommen auf den Markt.

Am 19. Dezember 2003 soll das Landegerät Beagle 2 in Richtung Marsoberfläche entsendet werden.
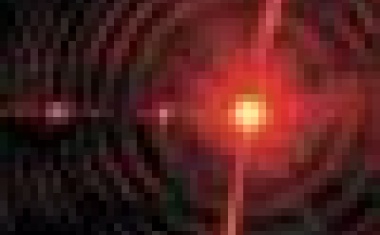
Besonders homogen hergestellte 50-nm-dünne Glasfasern zeigen überraschend geringe Übertragungsverluste.
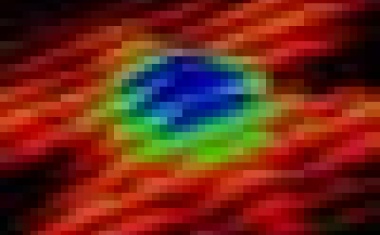
Mit einem neuen Verfahren lassen sich Lichtpulse im Attosekunden-Bereich erstmals direkt messen.

Einzelne Atome lassen sich dabei filmen, wie sie von einem Förderband aus Licht bewegt werden.

Europäische Klimaforscher fordern langfristige Vorgaben für den Übergang zu einer globalen Wirtschaft ohne Emissionen.
In Berlin, Leipzig und Frankfurt am Main sind mindestens 50.000 Studenten auf die Straße gegangen.

Die Europäische Mars-Mission geht in die entscheidende Phase. Bislang verläuft alles nach Plan.

Kleinstpartikel sind nicht nur bei der Chipherstellung ein Problem. Ein neues System erleichtert die Messung.
In Harvard hat man Licht zum völligen Stillstand gebracht und nach 10 Mikrosekunden weiterlaufen lassen.

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft gibt die Preisträger des Jahres 2004 bekannt.

Stuttgarter Physiker simulieren im Rechner, wie sich Sanddünen beim Wandern überholen.
In Dresden gelang es grün leuchtende organische Leuchtdioden (OLEDs) mit Rekord-Effizienzen herzustellen.

Die Krise in der kommerziellen Raumfahrt endet nach Ansicht des EADS-Konzerns erst 2006/2007.
Chemiker der Uni Jena haben zusammen mit fünf Projektpartnern viel versprechende Katalysator-Materialien entwickelt.
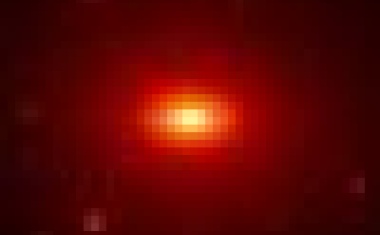
Neue Gammastrahlen-Teleskope könnten dunkle Materie erstmals "sehen" - dies versprechen Simulationen.
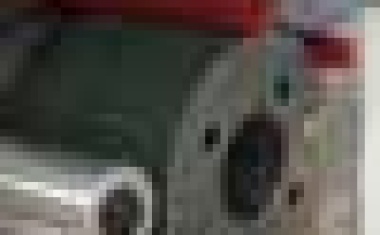
Forscher drucken erstmals Kunststoff-Transistoren in Massen - millionenfache Auflagen sind kein Problem mehr.
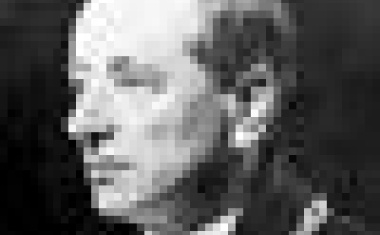
1953 erhielt Frits Zernike den Physik-Nobelpreis. Mit dem Phasenkontrastverfahren revolutionierte er die Mikroskopie.
In der Nanotechnologie ist Deutschland europaweit Spitze. Wie stark davon die Wirtschaft profitiert, kann jedoch niemand exakt vorhersagen.
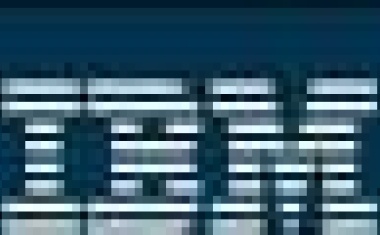
IBM gelingt ein großer Schritt bei der Miniaturisierung von Chips - Moleküle gruppieren sich selbstständig zu Schaltkreisen.
Bei der Schaffung neuer Klimaschutz-Instrumente bahnt sich ein gravierender Konflikt zwischen Rot-Grün und der Industrie an.