
Hochleistungslaser für die Wellenjäger
Das dritte und vorerst letzte Lasersystem für die amerikanischen Gravitationswellendetektoren LIGO hat seine Reise von Hannover nach Hanford (Washington) angetreten.

Das dritte und vorerst letzte Lasersystem für die amerikanischen Gravitationswellendetektoren LIGO hat seine Reise von Hannover nach Hanford (Washington) angetreten.

Europäische Partnerschaft erforscht hocheffiziente Silizium-Dünnschichtsolarmodule mit 9,3 Millionen Euro.

Team des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik in der Kategorie „Power and Propulsion“ für ihr Verfahren zum Additive Manufacturing von BLISKs ausgezeichnet.
Das Team des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT gewann die Innovation Challenge 2012 in der Kategorie »Power and Propulsion« für ihr Verfahren zum Additive Manufacturing von BLISKs.

Rekollisionen in Halbleitern erzeugen Licht, das für ultraschnellen Datentransport geeignet sein könnte.

9. Workshop „Industrielle Anwendungen von Hochleistungsdiodenlasern“ in Dresden.

North Star Imaging aus Rogers, Minnesota, eröffnet Europazentrale vor den Toren von Paris.

Advanced Optical Materials wird Artikel zu allen Aspekten von Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie beinhalten.

Kollegen ehren den Erfinder der Glaskeramik-Spiegelträger und einen der Väter der Ceran-Kochfläche.
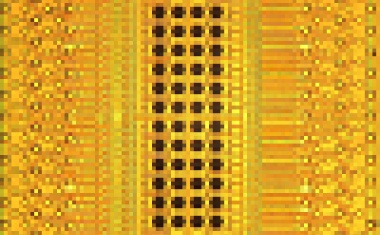
„Holey Optochip“-Technologie von IBM erzielt große Leistungssteigerung in der optischen Datenübertragung für Computersysteme.

Energieeffiziente Hochleistungslaser zur Materialbearbeitung erobern den Markt.
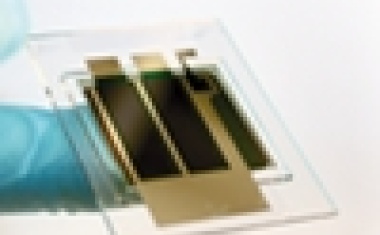
Die Heliatek GmbH hat am 12. März ihre erste Produktionsanlage zur Herstellung von organischen Solarmodulen in Dresden eingeweiht.

Mikro-Leuchtdioden sollen Implantate für Menschen mit Hörstörungen verbessern.

Auszeichnung für den nachhaltigen Transfer von besonders leistungsfähigen Diodenlasern für die Materialbearbeitung.

BMBF fördert im Rahmen des nun gestarteten Verbundprojekts FOKUS Forschungsarbeiten für die nächste Generation industrietauglicher Ultrakurzpulslaser.

Insgesamt 146 Aussteller aus zwölf Ländern präsentieren bis 21. März auf 5500 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre Innovationen.

Der German Pavilion ist auch im „Deutsch-Russischen Jahr der Wissenschaft“ auf der Photonica in Moskau präsent.

Photonische Kristalle und flüssigkeitsgefüllte Mikrokanäle ermöglichen neuartigen Laser.

DNA-Origami: maßgeschneiderte optische Materialien aus synthetischen Doppelhelizes.

Veranstaltung von Optence e.V. in Kooperation mit dem Photonik-Zentrum Kaiserslautern e.V. bringt führende Hersteller und Einrichtungen zusammen.

Verbessertes Verfahren steigert die Intensität von Terahertz-Laserpulsen deutlich.

Die Baden-Württemberg-Stiftung stellt vier Millionen Euro für Forschungsprogramm „Hybride Optische Technologien für die Sensorik“ zur Verfügung.
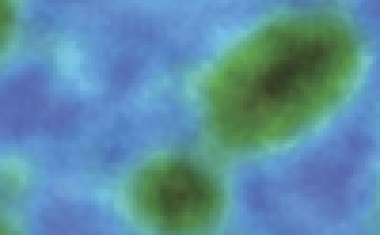
Aberrationsfreie Subnanometer-Auflösungen bei großem Beobachtungsfeld werden mit der Methode möglich.

Fast wie Formel 1: Hochpräzisions-zwei-Photonen-Lithographie bricht Geschwindigkeits-Rekorde.
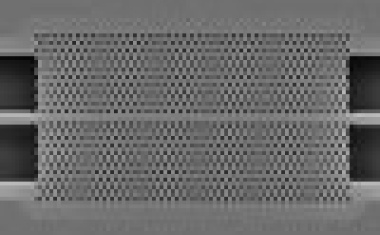
Neuartige Linse mit photonischem Kristall lässt sich für die optische Datenübertragung nutzen.

Faserverbundkunststoffe sind heutzutage in aller Munde, wenn es um Leichtbau geht. Für die Mobilität bedeuten Leichtbauteile geringeren Kraftstoffverbrauch und höhere Reichweite.
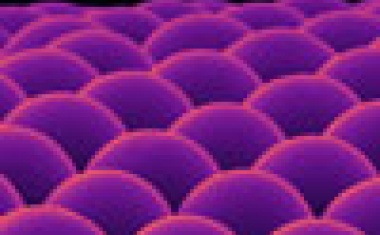
Natürlich gewachsene Oberflächenschichten mit einer regelmäßigen Anordnung von mikrometergroßen Kalklinsen können lithografische Mikrolinsenarrays aus Kunststoff ersetzen.

Forscher der Universität Leipzig arbeiten an Grundlagen für das Aufspüren heißer Nanoteilchen.
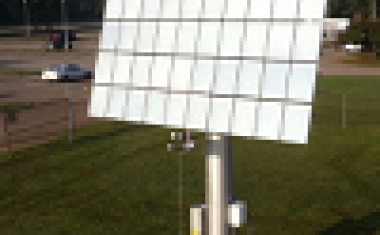
Das Photovoltaik-Unternehmen Semprius hat bei hochkonzentrierenden Photovoltaik(PV)-Modulen einen Rekord-Wirkungsgrad von 33,9 Prozent erreicht.

Kasseler Forschern gelingt Unterscheidung chiraler Moleküle per Femtosekunden-Laser.

Seit heute tagen 160 Experten für Ellipsometrie am Institut für Experimentelle Physik II der Universität Leipzig.

Wie organische Moleküle aus zwei roten Photonen ein gelbes machen.

Wärmeenergie des Diodenmaterials wird in Strahlung umgewandelt.

Berliner Wissenschaftler bekommen gleich zwei Wirkungsgrad-Rekorde für cadmiumfreie Dünnfilm-Solarmodule bestätigt.
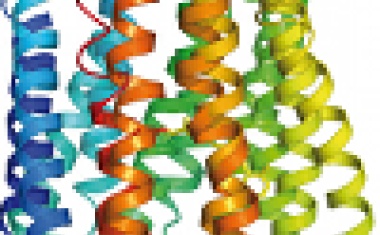
Forscher erklären mit Infrarotspektroskopie und Computersimulationen Funktion des Proteins Kanalrhodopsin.