
Strom aus der Hornisse
Strukturierung und Pigmente des Panzers der orientalischen Hornisse ermöglichen die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie.

Strukturierung und Pigmente des Panzers der orientalischen Hornisse ermöglichen die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie.

Polykristalline Graphenschichten zeigen eine komplexe Domänenstruktur, die ihre elektrischen Eigenschaften kaum beeinflusst.

Die Kombination aus optischen, Infrarot- und Röntgenaufnahmen erlaubt die Beobachtung des gesamten Sternenlebens.

In einer Ausstellung in Berlin werden Symmetrien mit Spiegeln spielerisch erfahrbar gemacht.
Erstmals erscheint eine umfangreiche Auswahl des Briefwechsels von Erwin Schrödinger, der vor fünfzig Jahren in seiner Heimatstadt Wien gestorben ist.

Eine Analyse der Form von Galaxien ergab keine Korrelation zwischen Kollisionen und Aktivität der Galaxienkerne.
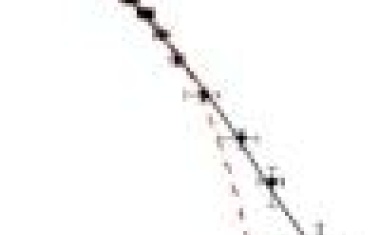
Kaskaden hochenergetischer Elektronen in Gewitterwolken haben unerwartete Spektren.

Mikrowellensensor kann Brandherde auch bei schlechter Sicht aufspüren.

Experiment auf der ISS zur Untersuchung des Kapillarverhaltens von Flüssigkeiten unter Schwerelosigkeit.

Durch äußere Spannungen lassen sich Komplexe aus organischen Molekülen und metallischen Atomen zwischen unterschiedlichen Bindungszuständen umschalten.

Unter hohem Druck geleitet Kohlendioxid Farbstoffe und Wirkstoffe in Polymere.

Daten des Pan-STARRS 1 Teleskops wurden erfolgreich im Klassenzimmer ausgewertet.

Der größte Staat Südamerikas wird das erste Mitgliedsland der ESO außerhalb Europas sein.

Eine in CMOS-Technik ausgeführte Kamera erreicht eine enorme Bildaufzeichnungsrate.

Ein Physiker bestimmt den Einfluss zufälliger Mutationen auf die Evolutionsgeschwindigkeit von Lebewesen.

Ein plasmonischer Sensor detektiert Viren zerstörungsfrei.
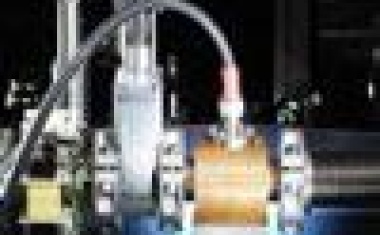
Eine wesentlich kleinere und günstigere Anlage zur zeitlich hochaufgelösten Aufnahme von Molekülbewegungen nutzt Elektronen anstelle von Röntgenstrahlung.

Die European Physical Society hat in einer Studie untersucht, wie die europäischen Länder die Masterstudiengänge in Physik gestalten.

Ceroxid für eine effizientere, katalytische Spaltung von Wasser und Kohlendioxid.

Mit einer neuen Methode lassen sich oberflächennahe Strukturen weicher Materialien zerstörungsfrei messen.

Ein Superkondensator mit Graphenelektroden erreicht Energiedichten wie NiMH-Akkus.

Einzelne Elektronenspins im Halbleiter lassen sich mit elektrischen Pulsen direkt manipulieren.

Das kurzlebige Molekül H2CCC ist eines der vielen, bisher unbekannten Moleküle, die im interstellaren Nebel Sternenlicht absorbieren.

(a) erstarrte Metallschmelze (b) antarktischer Gletscher (c) planetarischer Nebel
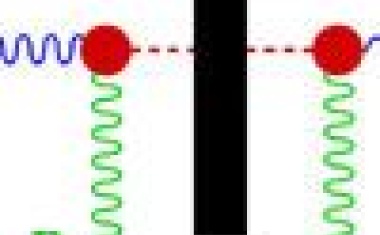
"Licht-durch-Wand" Experimente suchen nun auch im Röntgenbereich nach Kanditaten für Dunkle Materie.

Mit einer neuen, präziseren Methode können optische Antennen aus Gold hergestellt werden.

Der in Deutschland hergestellte Hochleistungs-Infrarotlaser soll erstmalig im Gravitiationswellendetektor LIGO zum Einsatz kommen.

Die Garchinger Neutronenquelle FRM II erhält 300 Millionen Euro.

Ein neu entwickeltes, bergbautaugliches Laseranalysesystem erkennt die Zusammensetzung von Gesteinsproben in Echtzeit.

Das IceCube-Observatorium am Südpol soll Neutrinos aus weit entfernten Galaxien nachweisen.

Astronomen beobachten seltenes Molekül innerhalb einer Geburtswolke von Sternen.

Kopplung zwischen magnetischen Wirbeln und sehr schwachem Strom könnte erheblich schnellere und effizientere Datenspeicherung ermöglichen.
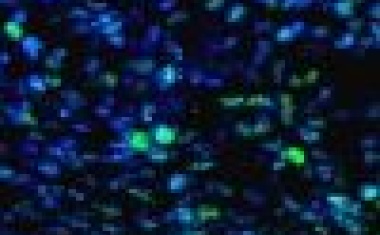
Gewebekulturen menschlicher Tumoren ermöglichen Erforschung der Ionenbestrahlung unter realen Bedingungen.
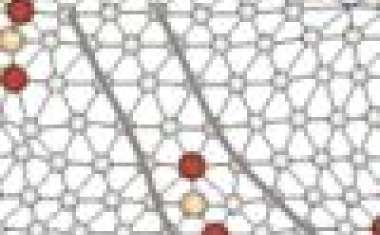
Ein von Textilien bekanntes Merkmal, die Falten, wurde bei zweidimensionalen Kristallen auf gekrümmten Flächen identifiziert.

Kerne von Phosphoratomen können sich digitale Daten fast zwei Minuten lang merken – Supraleiter als Spin-Filter.