
Magnetische Bits elektrisch schreiben
Speicherung von Daten in nanometergroßen Strukturen demonstriert.

Speicherung von Daten in nanometergroßen Strukturen demonstriert.

Vermessung des Schwerefeldes gibt Aufschluss über antarktische Eismassenschwankung.

Atomare Platinschicht auf Wolframcarbid-Träger katalysiert elektrolytische Wasserstoffherstellung.

Experimentell bestimmte Photoionisationsspektren erlauben Rückschlüsse aus Beobachtungen schwarzer Löcher.

Dotierte Eisenatome können sich wie isolierte Spinzustände verhalten.

Systematische Suche nach Planeten um sonnenähnliche Sterne liefert überraschende Resultate – Modelle der Planetenentstehung müssen überabeitet werden.

In einem Webcast werden die Ergebnisse eines Workshops der ESA über erdnahe Objekte und ihre Gefahren präsentiert.

Selbstorientierte magnetische Moleküle auf einer Goldoberfläche ändern ihre Magnetisierung sprunghaft.

Eine 3D-Aufnahme roter Blutkörperchen, Nanopartikel, Rosenblätter oder doch was ganz anderes?

Polaronen-Spin beeinflusst den Stromverlust in organischen Solarzellen.

Japanisches ISS-Instrument und NASA-Satellit Swift untersuchen Lichtblitz im Sternbild Zentaur.

Interview mit Ulrich Eckern über das Exzellenzzentrum für theoretische Physik im Westjordanland.
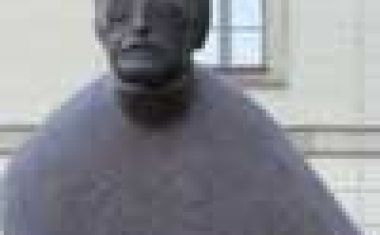
Ein „Gespenst im Nachthemd“ oder ein großes Kunstwerk. Die wechselhafte Geschichte des ersten Planck-Denkmals.

Die Physik ist unverzichtbar für die Simulation und Untersuchung von Materialeigenschaften.
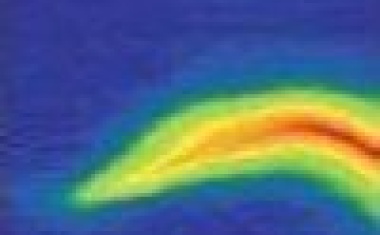
Forscher weisen erstmals magnetische Wellen bei nanometergroßen Mikrowellenstrahlern nach.
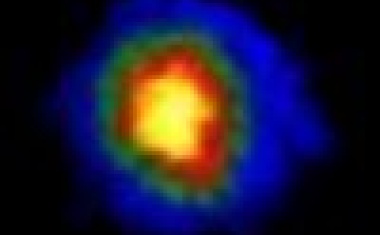
Forschern gelingt die Speicherung von Ionen in einer optischen Dipolfalle.

Spezielle Glasfasern können zum Messen von Materialdeformationen eingesetzt werden.
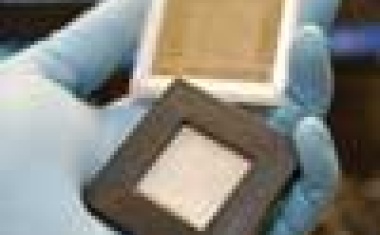
Ein elektrofluidisches Display kommt ohne ständige Energiezufuhr aus und erreicht die gleiche Reflektivität wie weißes Papier.

Satellitengestützte Radaraufnahmen ermöglichen Frühwarnung von Ausbrüchen gletscherbedeckter Vulkane.

Ein Array von Nanodrähten aus Bleizirkonattitanat wandelt mechanische in elektrische Energie und bringt dadurch eine Laserdiode zum Leuchten.
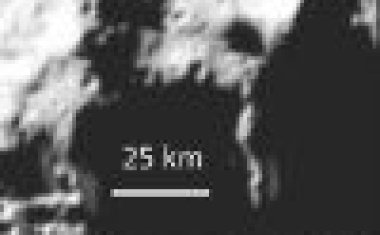
Mondboden im Cabeus-Krater enthält einen Wasseranteil von etwa 5,6 Prozent.
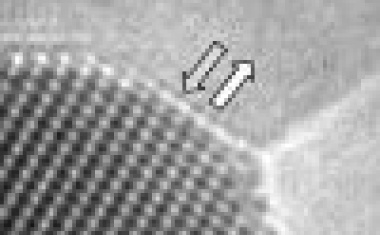
Mehrstufiges Wachstum von Aluminiumoxid-Nanodrähten in Echtzeit beobachtet.
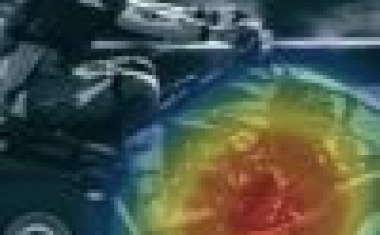
Entwicklung einer "Kamera" zur Visualisierung von Schallquellen.

Bose-Einstein-Kondensate tunneln zwischen Potentialmulden mit zeitabhängiger Energiedifferenz anders als nach der bekannten Landau-Zener-Formel erwartet.

13 Milliarden Jahre alte Galaxie gesichtet.

Beim Stromfluss durch Moleküle bewegen sich Atomkerne und Elektronen nicht unabhängig sondern gekoppelt.

Neuartiges Wasserkraftwerk ermöglicht Energiegewinnung an ungenutzten Standorten.

Ein eine Diskokugel, ein Bullauge oder doch etwas ganz anderes?

Mehr als 400 Forscher erhalten jeweils bis zu 2 Millionen Euro.

Die Häufigkeitsverteilungen vieler Arten menschlicher Kommunikation genügen derselben Statistik wie auch Erdbeben.
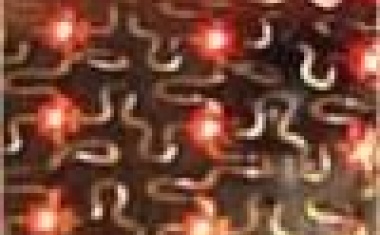
Vorteile organischer Leuchtdioden sind jetzt durch anorganischen Ansätze erreichbar. Wissenschaftler in den USA demonstrieren flexible und biokompatible mit LEDs bestückte Membranen.

Empa berechnet Umweltverträglichkeit verschiedener Leuchtmittel.
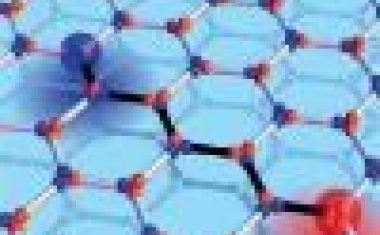
Bewegung magnetischer Monopole in künstlichem zweidimensionalen Material sichtbar gemacht.
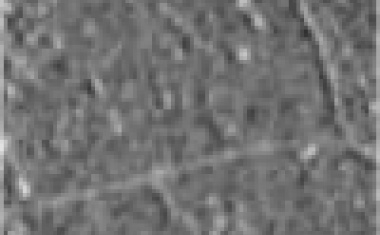
Forscher erfinden neue Materialien als Alternative zu Gold in elektronischen Anwendungen.

Wissenschaftler entwickeln photochemisches Verfahren zur Dotierung organischer Transistoren.