
Mit biegsamer Solarfolie in die Zukunft
Biegsame Solarzellen als Folie in Kleidung oder auf Autos werden künftig eine nahezu überall verfügbare Stromquelle bieten. Ein Gespräch mit Christoph Brabec.

Biegsame Solarzellen als Folie in Kleidung oder auf Autos werden künftig eine nahezu überall verfügbare Stromquelle bieten. Ein Gespräch mit Christoph Brabec.

Forschern ist es gelungen, Röntgenemissionsspektroskopie an einem freien Mikro-Flüssigkeitsstrahl durchzuführen.

Forscherteam kann Auftreten polarisations-verschränkter Photonenpaare durch indirekte Messungen nachweisen.

Deutsch-französischer Klimasatellit soll 2014 starten.

Wissenschaftler entdecken universelle Eigenschaft supraleitender Materialien.

Nanomechanische Schalter aus Siliziumkarbid arbeiten ohne Leckströme bei bis zu 500 Grad Celsius.

In einer gasgefüllten hohlen Glasfaser wurde Infrarotlicht auf ein 1200-stel der Lichtgeschwindigkeit abgebremst.
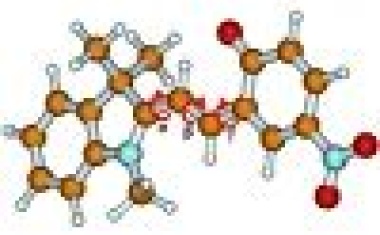
Eine kombinierte Methode aus Laserdesorption und Elektronenbeugung klärt Photoschaltvorgang eines komplexen Moleküls auf.
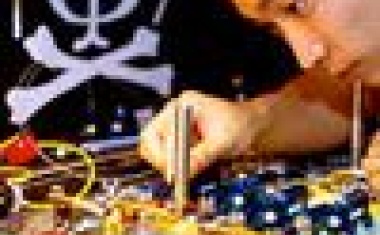
Lauschen ohne Spuren zu hinterlassen: die Blendung von Photodetektoren macht‘s möglich.
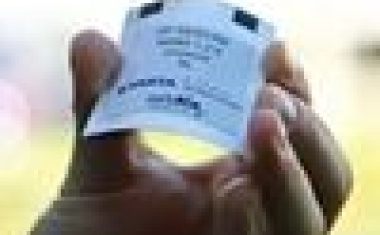
Kooperation von Hochschule und Unternehmen entwickelt günstige, umweltverträgliche Druck-Batterie.

Eine Plasmawolke, eine fluoreszierende Zelle oder doch etwas ganz anderes?

Neutronen- und Röntgenstreuung deckt Dynamik antiferromagnetischer Ordnung auf.

Die ESO veröffentlicht eine neue Aufnahme der der Milchstraße ähnelnden Spiralgalaxie NGC 300.

14. Deutsche Physikerinnentagung in München.

Forscher imitieren die Regeneration pflanzlicher Blätter, um die Lebensdauer organischer Solarzellen zu erhöhen.

Wasser entsteht in Kometen auf ungewöhnlichem Wege.

Umrankte Galaxien liefern neue Informationen über die Evolution von Spiralgalaxien.

Hochschulen reichen 227 Antragsskizzen ein.

Wissenschaftler bestimmen Halbwertszeit des Selen-Isotops genauer als bislang möglich.

Erste externe Nutzer an der neuen Synchrotronquelle begrüßt.

Ein einfaches Gerät misst das Quantenrauschen von Vakuumfluktuationen und liefert so echte Zufallszahlen.

Hochschulen reichen 227 Antragsskizzen ein.

Beobachtungen mit dem Hubble Space Telescope zeigen die Wechselwirkung der ausgestoßenen Materie mit dem interstellaren Medium.

Ein neues biophysikalisches Modellsystem untersucht das Gruppenverhalten von Nanomaschinen.

Durch ein spezielles Sputter-Verfahren zur Beschichtung von Glasoberflächen kann die Beschichtungseffizienz enorm erhöht werden.

Die Cluster-Mission der Europäischen Raumfahrtagentur wird verlängert.

Mit einer verbesserten Magnetresonanz-Tomografie können Organe und Gelenke jetzt auch in Echtzeit "gefilmt" werden.

Neuartige Fensterscheiben für Autos verhindern das Kondensieren von Flüssigkeit - so bleibt die Scheibe morgens eisfrei.

Abstoßende Casimir-Kräfte für ideale Leiter gefunden - zumindest theoretisch.
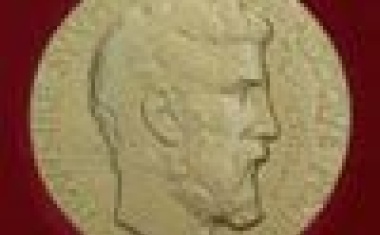
Die höchste Auszeichnung für Mathematiker wurde in diesem Jahr unter anderem für zwei physikalische Themen vergeben.

Der Abschluss „Diplom-Physiker“ sollte als weltweit anerkanntes Gütesiegel erhalten bleiben.

Der InterAcademy Council hat UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon Vorschläge zur Reform des Weltklimarates überreicht.

Sind in einer Flüssigkeit gelöste Teilchen heißer als ihre Umgebung, muss die Theorie der Brownschen Bewegung angepasst werden.

Neuer Sensor soll elektronische Funketiketten und Lichttapeten kostengünstiger machen.

Nach sechs Jahren Routinebetrieb wird der Forschungsreaktor FRM II umgerüstet, um u. a. ein für die Nuklearmedizin wichtiges Radioisotop herstellen zu können.