
Tag der Raumfahrt
Am dritten September-Wochenende 2004 findet der "Tag der Raumfahrt" statt. Die zentrale Veranstaltung ist in Köln.

Am dritten September-Wochenende 2004 findet der "Tag der Raumfahrt" statt. Die zentrale Veranstaltung ist in Köln.
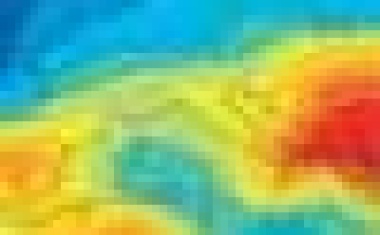
Amerikanische Klimaforscher gehen davon aus, dass Europa und Nordamerika in Zukunft häufiger von längeren Hitzeperioden heimgesucht werden.

Am 7. September 2004 laden Rostocker Uni-Physiker wieder Schülerinnen und Schüler zum Physikertag ein.
Physiker aus Frankreich haben ein neues Modell entwickelt, durch das sich „exotische“ chemische Reaktionen, die mit Myonen stattfinden, besser verstehen lassen.

Physik Journal - Jenaer Forscher haben eine extrem flache Kamera entwickelt, die Licht mit 16.000 Mikrolinsen einsammelt.
Deutschlands Studenten wenden im Durchschnitt 42 Stunden pro Woche für Erststudium und Nebenjob auf.
Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) will sich mit den SPD-Wissenschaftsministern auf ein einheitliches Studienkonten-Modell verständigen.

Ein ungewöhnlicher Gammablitz widerlegt die bisherige Meinung, dass alle Ausbrüche kosmischer Gammastrahlen ähnliche Energiemengen freisetzen.
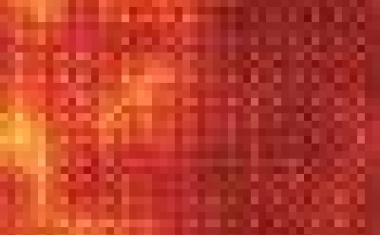
Entfernt man gezielt einige Sauerstoffatome aus Metalloxiden, so verbessern sich die elektronischen Eigenschaften - vielleicht ein Chipmaterial der Zukunft?
Studenten sollen zur Finanzierung von Studiengebühren nach den Vorstellungen von CDU-Vize Annette Schavan günstige Kredite aufnehmen können.

Mainzer Forscher haben eine neue Form von Stickstoff hergestellt, die als Energiespeicher dienen könnte.
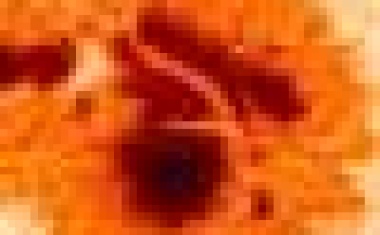
Neuen Studien zufolge beeinflusst die Sonnenaktivität das Klima. Bei der aktuellen globalen Erwärmung spielt sie aber nur eine geringe Rolle.

Fraunhofer-Forscher erwarten beim Bau von Energiesparhäusern ein hoch dynamisches Wachstum.

Intel hat auf dem Weg zu immer kleineren Chipstrukturen einen «bedeutenden Meilenstein» erreicht.

Ein im Sultanat Oman entdeckter Meteorit stammt genau aus dem rechten Auge des «Mannes im Mond».
Wie wird man in Großbritannien oder in den USA Professor? Ein Überblick über zwei unterschiedliche Systeme.
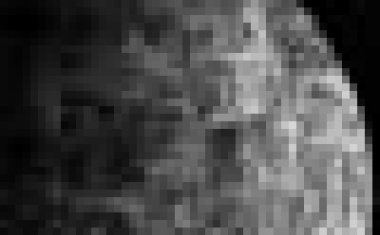
Erstmals seit mehr als 30 Jahren startet mit der Sonde «Messenger» wieder eine Merkur-Expedition.

Reibung spielt in Geologie, Technik und Biologie eine zentrale Rolle. Will man sie beschreiben, wird's kompliziert.
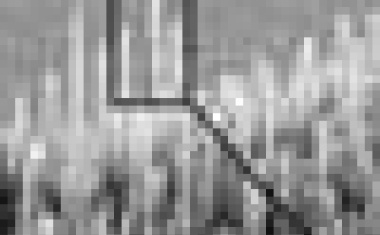
Winzige Zinkoxid-Nadeln haben "Flüstergalerie"-Eigenschaften für sichtbares Licht.

Karlsruher Forscher haben eine neue Laser-Methode entwickelt, um spezielle Photonische Kristalle herzustellen.

Sonne, Mond und Sterne im August - der Sternschnuppenstrom der Perseiden ist in diesem Jahr besonders aktiv.
Kürzlich gelang in einem Experiment die Verknüpfung von insgesamt fünf Lichtteilchen. Das ist Weltrekord.

Ein internationales Forscherteam konnte erstmals die atomare Struktur winziger Metall-Nanoteilchen aufklären.
Erstmals wurden überzeugende Indizien für die reibungsfreie Strömung der Teilchen in Fermi-Kondensaten gefunden.

Mit der Spitze eines Rastertunnelmikroskops lassen sich einzelne Goldatome reversibel mit einer zusätzlichen Elektronenladung versehen.

Physik gestern und heute - Die Zeit wurde bereits sehr früh gemessen. (aus: "Physik in unserer Zeit")
Der unterste Bereich des Erdmantels besteht nach neusten Erkenntnissen aus einem bisher unbekannten Mineral.

Astrophysiker widerlegen mit Teleskopbildern die Annahme vom kontinuierlichen Übergang heller und dunkler Sonnenflecken.

Wohnraum und Wohnheimplätze für Studenten werden nach Angaben des Deutschen Studentenwerks immer knapper.

Die Eigenschaften von Formgedächtnis-Legierungen lassen sich berechnen. Eine mögliche Anwendung wären knitterfreie Hemden.
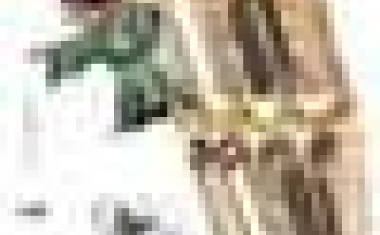
Das historische Rätsel aus der Zeitschrift "Physik in unserer Zeit". Wer war der diplomatische Luftforscher?
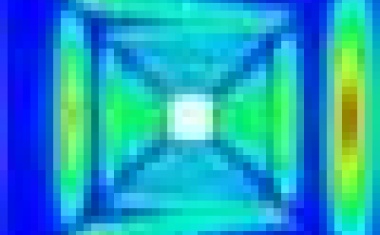
In Greifswald wurde ein Wellenleiter für den geplanten Fusionsreaktor ITER erfolgreich getestet.

Ketten kosmischer Staubpartikel könnten die Grundlage für Planetenbildung sein.

Ein australisches Wetterphänomen soll als Forschungsgrundlage zur besseren Vorhersage tropischer Stürme dienen.

Dresden - Vor einer Laserbehandlung am Auge führen Arrays winziger, mechanisch bewegbarer Spiegel dem Patienten vor, wie er später sehen wird.