
Deutsche Lasertechnologie gewinnt „Oscar der Photonikindustrie“
Nanoplus für die Entwicklung von Halbleiterlaserdioden für die Gassensorik ausgezeichnet.

Nanoplus für die Entwicklung von Halbleiterlaserdioden für die Gassensorik ausgezeichnet.

Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik, Biotechnologie u.a. präsentieren ihr Stellenangebot für Physiker, Chemiker, Pharmazeuten, Ingenieure, Informatiker ...
Synthese auf nichtleitenden Oberflächen
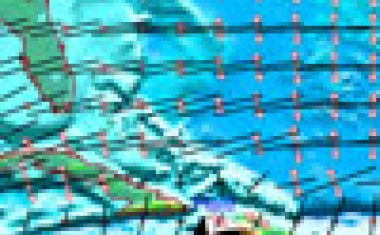
Neues, geodynamisches Modell verfeinert Theorie der Plattentektonik und soll seltene Erdbeben erklären helfen.
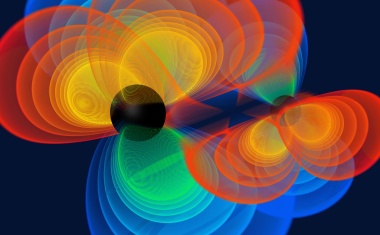
Nach dem Ausstieg der NASA aus dem LISA-Projekt haben europäische Wissenschaftler nun bei der ESA das Konzept für das New Gravitational Wave Observatory (NGO) vorgelegt.

Im November waren über 100.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgerufen, die DFG-Fachkollegien zu wählen.

Siliziumnanodrähte verbessern die Auflösung von Magnetresonanzkraftmikroskopen.
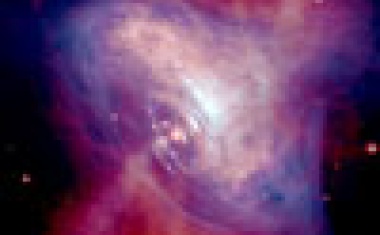
Die gepulste Höchstenergiestrahlung vom Krebspulsar beruht auf der abrupten Beschleunigung eines ultraschnellen Winds aus „kalten“ Elektronen und Positronen.

Die Arbeitsgruppe von Dieter Bimberg vom Institut für Festkörperphysik der TU Berlin erhielt einen Green Photonics Award.

Am 7. Februar übergab der langjährige wissenschaftliche Leiter des Magnus-Hauses Berlin, Günter Kaindl, die Leitung an seinen Nachfolger, Wolfgang Eberhardt.

Finanzierung der Michelin Development GmbH unterstützt KIT-Spinoff beim Schaffen neuer Arbeitsplätze.

Die Analyse von Streulicht deutet auf deutlich niedrigere Temperaturen hin als bislang angenommen und erlaubt Rückschlüsse auf den Eruptionsmechanismus.

Verfahren der künstlichen Intelligenz legen bei der Quantenchemie den Turbo ein.

Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik feiert Jubiläum und weiht Erweiterungsbau ein.

Am internationalen Beschleunigerzentrum FAIR in Darmstadt, einem der größten Vorhaben der physikalischen Grundlagenforschung weltweit, beginnt eine entscheidende Ausbauphase
Kooperationsvertrag zur Weiterentwicklung der Saatguttechnologie
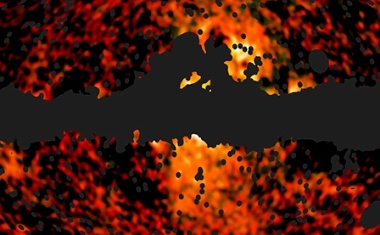
Astronomen entdecken beim Kartieren der kosmischen Hintergrundstrahlung unbekannte Details unserer eigenen Galaxie.
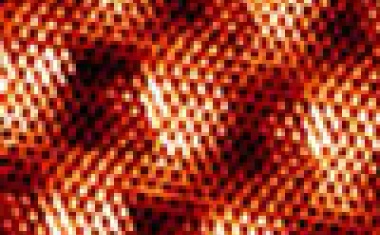
HZB-Wissenschaftler machen Oberflächenzustände für Spintronik-Anwendungen haltbar.

Ob Laserhersteller, Anwender oder Einsteiger – der AKL’12 trägt für jede Zielgruppe innovative Praxisbeispiele aus der Industrie und jüngste Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft zusammen.

Simulationen zufolge zerstört das Schwerkraft-Chaos während eines Starbursts kleinere Ansammlungen in recht kurzer Zeit.
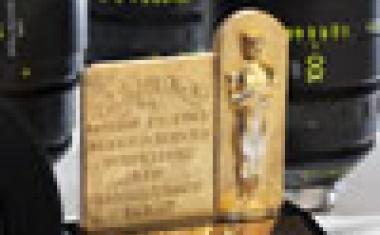
Zwei Ingenieure von Carl Zeiss nahmen im Vorfeld der Oscar-Verleihung einen Sci-Tech Award in Los Angeles entgegen.

Neue präzise Massenmessungen von Palladium-110 machen dieses Isotop zu einem vielversprechenden Kandidaten für den neutrinolosen Doppelbetazerfall.

Die neue Esa-Trägerrakete Vega hat heute Vormittag ihren Qualifikationsflug von Europas Raumflughafen in Kourou aus absolviert.
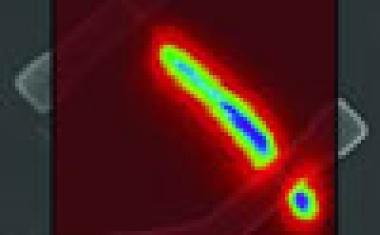
Forscher der Universität Duisburg-Essen haben eine ausgeklügelte Methode entwickelt, Nanodrähte für ultraleichte Solarzellen nutzbar zu machen.
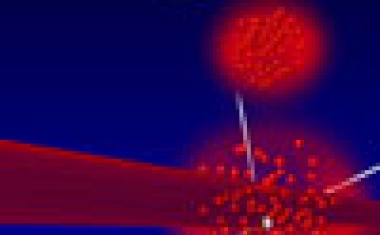
Am Atominstitut der TU Wien gelang es erstmals, Quanten-Korrelationen von Atomen während dem Bilden eines BECs zu messen.

Die optimale Reflektoranordnung von Spiegel-Solar-Kraftwerken hat die Form einer Fermatschen Spirale.
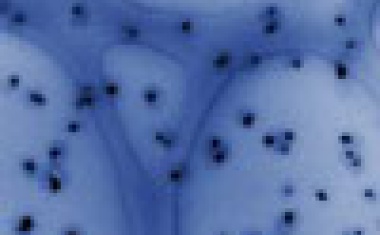
Biopolymer-Film lässt sich kostengünstig und umweltverträglich mit Informationen beschreiben.
32 Maschinenbau-Studenten der FH Regensburg konnten ihre Entwürfe an den hohen Anforderungen der Praxis messen lassen.
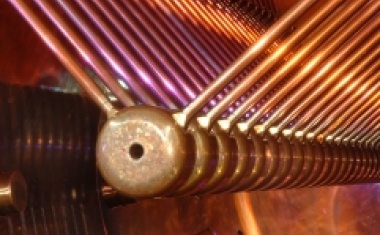
Die Zahl neuer, superschwerer Elemente hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sprunghaft erhöht. Derzeit laufen Experimente zur Synthese der Elemente 119 und 120. Damit ist die Insel der Stabilität erreicht.

Koaxialer Nanozylinder aus Verbindungshalbleitern emittiert Infrarotlicht.

Mit 20.324 Fachbesuchern und mehr als 1200 ausstellenden Firmen läutete die bedeutendste US-Fachmesse für Photonik ein vielversprechendes Jahr für die Branche ein.

Astronomen beobachten, wie sich ein kleines Sternsystem ein noch kleineres einverleibt

Einem Desy-Team gelang es, Atomkerne mit Hilfe von Röntgenlicht transparent zu machen und gleichzeitig ein neues Prinzip, um einen optisch gesteuerten Schalter für Licht herzustellen.

Im neuen bundesweiten Projekt "Netzwerk Teilchenwelt" können Jugendliche eigene Forschungsprojekte aus der Astroteilchenphysik durchführen.