
Bewegte Elektronen
Chemische Reaktionen lassen sich erstmals über die Steuerung der Elektronenbewegung in den beteiligten Atomen beeinflussen.

Chemische Reaktionen lassen sich erstmals über die Steuerung der Elektronenbewegung in den beteiligten Atomen beeinflussen.

Amerikanischen Forschern gelang ein großer Schritt bei Verbesserung der Lebensdauer und Lichtausbeute von OLEDs.

Heidelberger Physiker machen Schwankungen in gekoppelten BEC für Temperaturmessung nutzbar.

Mehr als 800.000 Seiten zur Physik und Astronomie gehen online.

Das bisher anspruchsvollste Manöver der Raumsonde Venus Express auf dem Weg zu unserem Nachbarplaneten ist geglückt.

US-Raumfahrtbehörde NASA feiert den 25. Jahrestag des Jungfernfluges einer Raumfähre ins All.

Ein neues Phasenkontrastverfahren liefert ohne großen Aufwand detailreichere Aufnahmen.
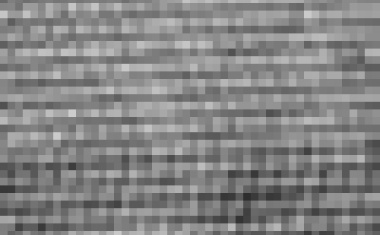
Japanische Forscher haben erstmals dünne Filme aus kristallinem Silizium im Sprühverfahren erzeugt.

Physik Journal - Ein neuer Monitor von Philips verspricht einen räumlichen Eindruck ohne spezielle Brillen.
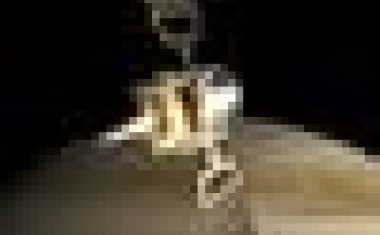
Europas erste Expedition zum Planeten Venus steht vor dem "heikelsten Moment" der Reise.

Aus Goldnanopartikeln und langen DNA-Strängen lassen sich gezielt periodische Nanostrukturen herstellen.
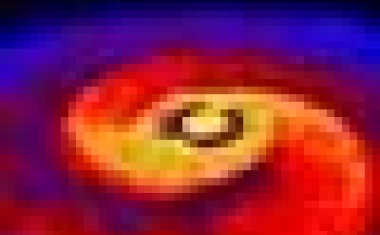
Bei der Kollision von Neutronensternen entstehen die stärksten Magnetfelder des Universums.
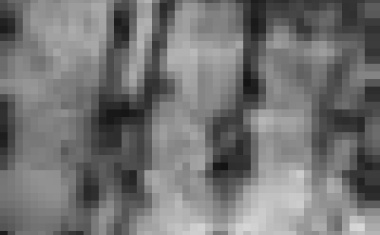
Nanosäulen aus Keramik sorgen dafür, dass der Strom auch in Anwesenheit starker Magnetfelder verlustfrei fließen kann.

Jeder dritte Existenzgründer weiß beim Schritt in die Selbstständigkeit nicht genau über Fördermittel Bescheid.

Zahllose Beobachter verfolgten in Afrika und dem Mittelmeerraum die totale Sonnenfinsternis.

Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Dortmund

Die Wetteraussichten sind für Beobachter in Deutschland eher schlecht.

Elektronen können offensichtlich doch Zustände oberhalb des Vakuum-Niveaus besetzen.

Nervenzellen wachsen zufällig. Sie nutzen störendes Rauschen zur Signalverstärkung.

Einem deutsch-italienischem Forscherteam gelingt ein entscheidender Schritt zur Herstellung organischer Halbleiter aus synthetischen Makromolekülen.

Photonische Schaltkreise, die Plasmonen ausnutzen, arbeiten mit Strukturen, die kleiner sind als die verwendete Wellenlänge des Lichts.
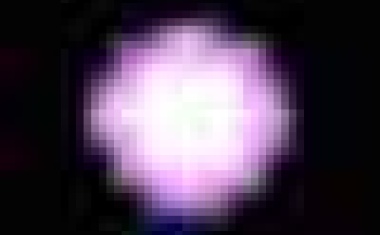
Astronomen haben einen "Braunen Zwerg" entdeckt, der nur 12,7 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Die totale Sonnenfinsternis am 29. März 2006 lässt sich in der Türkei zur besten Beobachtungszeit bewundern.

Die Ladungsträgerbeweglichkeit eines neu entwickelten Polymers ist erstmals so gut wie bei amorphem Silizium.

Ein anschaulicher Vergleich für die Kollegen in Hawaii: In die Öffnung der Bonner Riesenkamera passen 16 Ananas.

Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in München.

US Wissenschaftler sind sich sicher - die Zunahme der Meerestemperatur führt zu heftigeren Hurrikanen.

Brachte Dunkle Materie die ersten Sterne zum Leuchten?

Teilchen, die sich eigentlich abstoßen müssten, ziehen sich gegenseitig an.

Innsbrucker Physiker bestätigen 35 Jahre alte Theorie von Vitali Efimov.

Didaktiker diskutieren in Kassel über Schulunterricht und Lehrerausbildung

Bekommt die Quantenkryptographie bald "klassische" Konkurrenz?

Ein Gehirntumor lässt sich nur sehr schwer behandeln. Die Lösung der Zukunft könnte ein Protonenstrahl sein, der von einem Laser erzeugt wird.

Der amerikanische Satellit Swift hat den bislang ältesten Gammaausbruchs registriert.
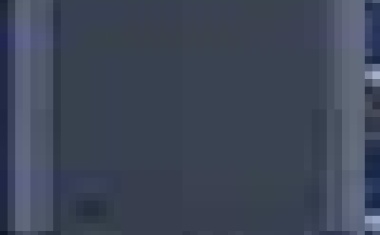
Spezielle Metalloxidfilme zeigen einen unerwartet hohen elektrokalorischen Effekt. Vielleicht die Chipkühlung der Zukunft?