
Empfindliche Spürnase
Ein Nanoröhren-Sensor kann kleinste Mengen eines Nitro-Sprengstoffs nachweisen.

Ein Nanoröhren-Sensor kann kleinste Mengen eines Nitro-Sprengstoffs nachweisen.
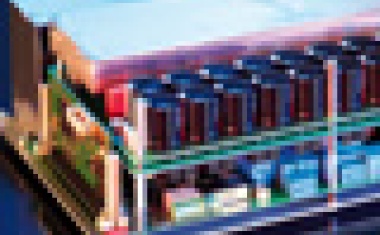
Ein neues Ladegerät für Elektrofahrzeuge schafft 22 kW bei hoher Leistungsdichte.

Das e-print-Archiv arXiv feiert 20. Geburtstag. Sein Begründer Paul Ginsparg ist auf der Suche nach einer neuen Finanzierung.
Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt hat den ersten Magnet für den Super-Fragmentseparator des Beschleuniger-Neubaus Fair erhalten.

Das Shanghai-Ranking präsentiert die Liste der weltweit besten Hochschulen, u. a. für das Fach Physik.
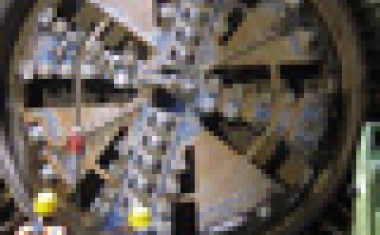
Mit dem Durchstich des Haupttunnels ist ein Meilenstein bei den Bauarbeiten erreicht. Auch die Finanzierungslücke ist geschlossen.

Der Vorstand von Q.Cells räumt erhebliche Verluste für das erste Halbjahr 2011 ein.

Eine Studie untersucht die Entwicklung des Fachkräfteangebots für die sog. MINT-Berufe.

Die Papiere von Samuel Goudsmit, Mitentdecker des Elektronenspins und wissenschaftlicher Leiter der Alsos-Mission, sind online.

Deutsche Schüler haben am vergangenen Wochenende beim IYPT in Teheran die Goldmedaille errungen. 2012 wird der Wettkampf erstmals in Deutschland stattfinden.

Erstmals ließen sich Daten mit 26 Terabit pro Sekunde auf einen Laserstrahl kodieren und übertragen.
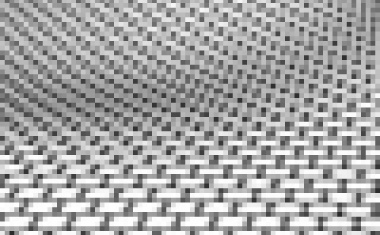
Integrierte Graphen-Schaltkreise werden langsam Wafer-tauglich.

Online-Angebot des Physik Journal im neuen Gewand

Zum 125. Geburtstag von Walter Schottky

Eine Kombination aus LED- und Sonnenlicht ermöglicht eine energieeffiziente Innenbeleuchtung.

Die neuen Möglichkeiten der Lehramtsausbildung sollten genutzt werden.

Elastische CIGS-Zellen erreichen einen Wirkungsgrad von 18,7 Prozent.

100. Geburtstag des Physikers und Strahlenbiologen Karl Günther Zimmer

Der bemannte Zugang zur Internationalen Raumstation ist vorerst nur noch mit Sojus-Kapseln möglich.

Der Wettbewerb um die großangelegten Flagship-Projekte der EU geht in eine neue Runde.

In diesem Jahr gilt es, 100 Jahre Supraleitung, 75 Jahre Typ-II-Supraleitung, 50 Jahre Flussquantisierung und 25 Jahre Hochtemperatur-Supraleitung zu feiern.


Bereits kurz nach dem Start des Spaceshuttle Endeavour begann das Alpha Magnetic Spectrometer mit den Messungen.

Dank Mikrooptik kann ein Mikroskop schnell ein großes Feld mit hoher Auflösung erfassen.

Die Zusammenarbeit von Chemie und Physik ist essenziell für die Lösung der großen Zukunftsfragen.

Mit einer wiederholbaren Fehlerkorrektur können auftretende Fehler bei der Datenverarbeitung mit Quantencomputern schnell und elegant rückgängig gemacht werden.

Entgegen dem Trend und der Notwendigkeit zu verstärkten Auslandsaufenthalten hat sich die Förderung durch den DAAD verschlechtert.

Mit einem denkbar winzigen Speicher könnte sich ein leistungsfähiger Quantencomputer konstruieren lassen.
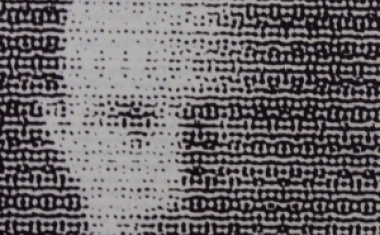
Eine Ausstellung in Heidelberg zeigt Werke von Ecke Bonk, der das Weltbild der Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, künstlerisch auslotet.
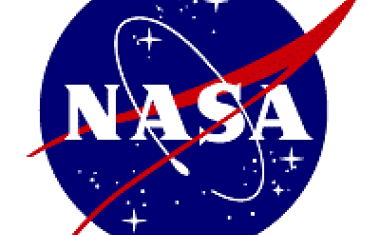
Ausstieg der NASA beeinflusst Forschungsmissionen des nächsten Jahrzehnts.

Am 8. April 1911 entdeckte Heike Kamerlingh Onnes das Phänomen der Supraleitung.
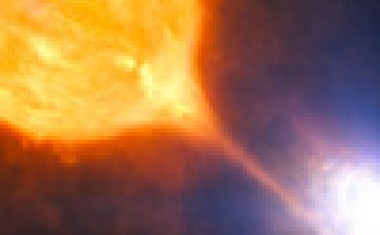
Mit einer neuen Beobachtungsmethode könnte bald der direkte Nachweis Schwarzer Löcher gelingen.

Physik Journal - Zehn Jahre „Physik sozio-ökonomischer Systeme“ in der DPG
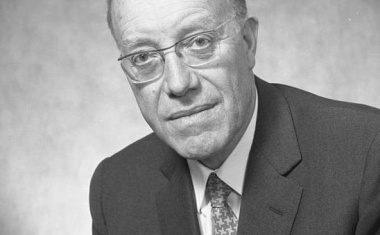
Am 28. März 2011 wäre der Kernphysiker Heinz Maier-Leibnitz 100 Jahre alt geworden.