
Komplexe Plattentektonik
Die Plattentektonik ist offensichtlich komplexer als bisher angenommen. Untersuchungen von Kieler Meeresforschern widersprechen der klassischen Theorie.

Die Plattentektonik ist offensichtlich komplexer als bisher angenommen. Untersuchungen von Kieler Meeresforschern widersprechen der klassischen Theorie.

Innsbrucker Quantenphysiker haben eine neue Methode zur Kontrolle des Bindungszustands von ultrakalten Molekülen entwickelt.

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) kritisiert, dass in den sieben Bundesländern mit Studiengebühren noch immer keine Stipendienprogramme zur sozialen Abfederung aufgelegt worden sind.

Ein internationales Team um Freiburger Quantenphysiker kann mithilfe einer einfachen Formel erstmals die Lebensdauer einer Verschränkung unter sehr allgemeinen Bedingungen bestimmen.

Die Hoffnung vieler Astronomen wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen: Der Asteroid "2007 WD5" wird wohl doch nicht auf dem Mars einschlagen.

Forscher aus Hannover tricksen die Quantenphysik aus und ordnen die Lichtteilchen eines Laserstrahls gleichmäßig an.
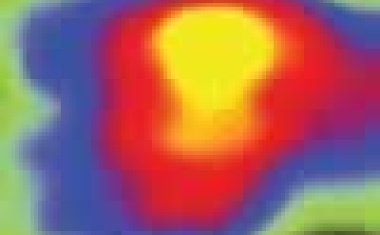
Parawasserstoff liefert ein so starkes Magnetresonanz-Signal, dass sich ein katalytischer Reaktionsverlauf mit einer zeitlichen Auflösung im Millisekundenbereich auf wenige Millimeter genau verfolgen lässt.

Messungen am Pierre Auger Observatorium geben Aufschluss über Photoneneigenschaften auf der Planck-Skala.

Ziffern, Spiele, Knobeleien: Unter dem Motto «Alles, was zählt» hat Bundesforschungsministerin Annette Schavan (CDU) das «Jahr der Mathematik» beginnen lassen.

Die 27 Staaten der Europäischen Union müssen im Kampf gegen den Klimawandel jetzt Farbe bekennen.

Deutschland kann die Folgen des EU-Gesetzespakets zum Klimaschutz nach Ansicht des Mannheimer Wirtschaftsforschers Andreas Löschel gut schultern.

Wissenschaftlern aus Heidelberg, Wien und China gelang die experimentelle Übertragung eines unbekannten Quantenzustandes mit zwischenzeitlicher Speicherung.

Aus der Wirtschaft kommen erneut Bedenken gegen den Atomausstieg in Stufen bis 2020 oder 2022. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BBE) sieht dies anders.

Der Motorenhersteller MAN Diesel, der Optikspezialist LIMO und das Solartechnikunternehmen Concentrix Solar sind mit dem Innovationspreis der deutschen Wirtschaft geehrt worden.

Die ostdeutschen Bundesländer profitieren auch in diesem Jahr von der boomenden Solarbranche. Millioneninvestitionen und Hunderte neuer Arbeitsplätze sind angekündigt.

Bochumer Forscher entwickeln eine neue Analyse-Methode, um magnetische Eigenschaften von Materialien auf der Nanometerskala untersuchen zu können.
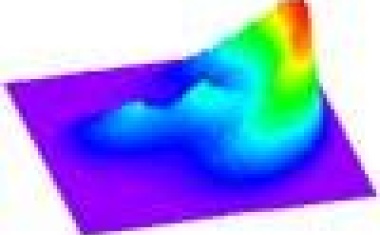
Freiburger Physiker entschlüsseln den Ablauf von Austauschreaktionen.

Dresdner Forscher nutzen einzelne DNA-Stränge als Werkzeug zum Sortieren von Kohlenstoff-Nanoröhrchen.

Bei der Entstehung von Sanddünen spielen zusätzlich zum Wind auch elektrostatische Ladungen eine wesentliche Rolle.

1935 bemerkte der italienische Physiker Ugo Fano asymmetrische Linienprofile in atomaren Anregungsspektren. Eine neue Form dieses Fano-Effekts gestattet nun neue Einblicke in künstliche Atome.

Die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission zur Klimaschutz- und Energiepolitik stoßen in Deutschland teilweise auf deutliche Ablehnung.

Die beobachtete Zunahme schwerer Hurrikans in den vergangenen Jahren geht nach Erkenntnis Kieler Forscher zu einem wesentlichen Teil auf natürliche Klimaschwankungen zurück.

Die Abgeordneten des Europaparlaments sprachen sich in Straßburg mehrheitlich für 2015 als Startdatum strengerer CO2-Grenzwerte aus, statt 2012 wie von der EU-Kommission gewünscht.

Die Schott Solar GmbH will bis zu eine halbe Milliarde US-Dollar (338 Millionen Euro) in den Bau einer US-Produktionsstätte für Solartechnologien investieren.

Mithilfe der 3D-Röntgenfluoreszenzanalyse sollen die über 2000 Jahre alten Schriftrollen vom Toten Meer neue Geheimnisse preisgeben.

Erstmals seit drei Jahrzehnten ist wieder eine Raumsonde nahe am Planeten Merkur vorbeigeflogen.

Die Solarstrombranche will auch in diesem Jahr kräftig zulegen. Der Bundesverband Solarwirtschaft erwartet, dass der Markt 2008 zweistellig wächst.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» könnte das satellitengestützte europäische Navigationssystem Galileo dramatisch teurer werden.

Das Debakel um den Start des Space-Shuttles «Atlantis» hat in den USA besorgte Debatten ausgelöst. Erstmals werden Sicherheitsrisiken der altersschwachen US-Raumfähren offen angeprangert.
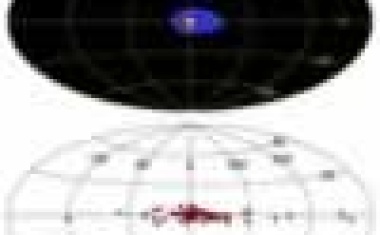
Mit dem Satellit INTEGRAL wurde eine ungleiche Verteilung von Positronen entdeckt. Garchinger Forscher vermuten Röntgendoppelsterne als deren Quellen.
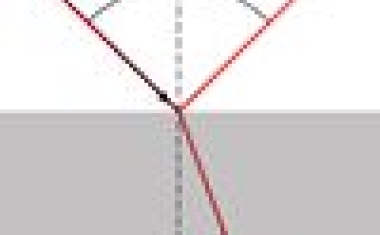
Wer hätte gedacht, dass sich bei der Lichtbrechung noch Überraschendes entdecken lässt: US-amerikanische Forscher fanden winzige Abweichungen vom Brechungsgesetz.
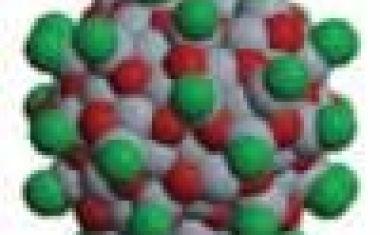
Karlsruher Forscher konnten vier neue, besonders große Clusterkomplexe mit fast 500 Silberatomen synthetisieren und deren Kristallstruktur ermitteln.

Der Forschungseisbrecher «Polarstern» hat für das Frachtschiff «Naja Arctica» mit der neuen deutschen Polarstation «Neumayer III» an Bord ein erstes Teilstück einer Fahrrinne durch das Antarktis-Eis gebrochen.

Die NASA-Sonde beginnt beim ersten Vorbeiflug am Merkur mit der Erforschung des „großen Unbekannten“ im Sonnensystem.

Auf Europas Industrie kommen ehrgeizige und milliardenteure Klimaschutzziele zu. Das geht aus einem Entwurf für das mit Spannung erwartete EU-Gesetzespaket hervor.