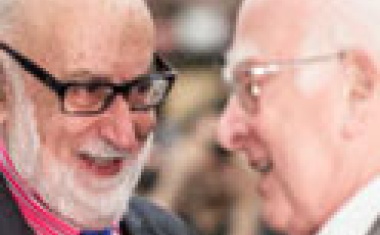
Nobelpreis für Physik geht an Englert und Higgs
Die beiden Theoretiker erhalten die Auszeichnung für die Entdeckung des Higgs-Mechanismus.
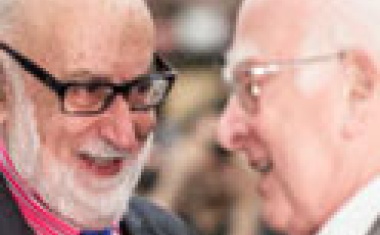
Die beiden Theoretiker erhalten die Auszeichnung für die Entdeckung des Higgs-Mechanismus.

Erste Beobachtungskampagnen beginnen, um den Sonnenvorbeiflug des Kometen genau zu untersuchen.

Auszeichnung für Pionierarbeiten auf dem Gebiet der kosmischen Magnetohydrodynamik.

First Light für Artemis – neues Instrument für APEX, dem Atacama Pathfinder Experiment.

Harald Lesch hält öffentlichen Abendvortrag der Astronomischen Gesellschaft (AG) in Tübingen.
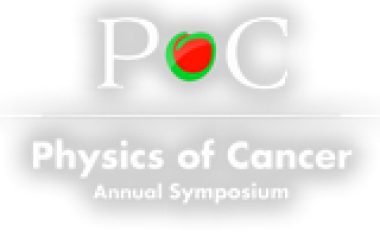
Leipziger Biophysiker laden vom 24. bis 27. September zu großer Konferenz.

Theorie-Workshop über niederenergetische Präzisionsexperimente soll Suche nach Teilchen und Kräften koordinieren.

Die Astronomische Gesellschaft tagt vom 23. bis 27. September in der Universitätsstadt im mittleren Neckartal.

Ostwestfälische Firma erhält den Preis zur EMO 2013 für laserunterstütztes Fräswerkzeug.

Kometenlander, Parabelflieger und Zentrifuge – diese und weitere Fassetten der Raumfahrt zeigt das DLR in Köln.

Erste dedizierte Auszeichnung für Quanteninformationsverarbeitung und -kommunikation.

Deutsches Nahinfrarot-Spektrometer für das James-Webb-Teleskop fertiggestellt.

„Todesstrahl“ vom Hochhaus Fenchurch 20 in London traktiert Jaguar.

Netzwerk EuHIT schafft Rahmen für Zugang zu den besten Turbulenz-Forschungsanlagen Europas.

EUMETSAT und US-Wetter- und Meeresbehörde NOAA kooperieren bei Wetter, Weltmeeren und Klima.

DLR und elf weitere Raumfahrtagenturen veröffentlichen neue Roadmap.

Freigabe für den Neubau des Materialwissenschaftlichen Zentrums für Energiesysteme am KIT.

Preiskomitee der Bose-Einstein-Konferenzen ehrt den Quantenphysiker.

Lisa Kaltenegger zum Mitglied der Simons-Stiftung ernannt.

Die 31. Internationale Konferenz über Gitterfeldtheorie „Lattice 2013“ findet diese Woche in Mainz statt.

Erste Beschleunigerstruktur des Linearbeschleunigers ist fertiggestellt und befindet sich im Hochleistungstest.

Deutsch-amerikanisches Stratosphären-Observatorium SOFIA beobachtet den Himmel der südlichen Hemisphäre.

DLR startete Höhenforschungsrakete Mapheus-4 mit Experimenten der Materialphysik.
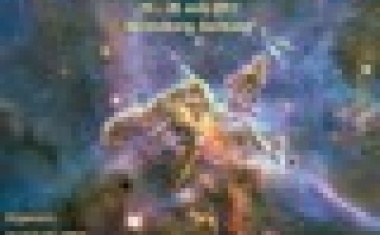
900 Wissenschaftler aus der ganzen Welt kommen nach Heidelberg zur sechsten „Protostars & Planets“.

Von der Weltraumforschung hin zur industriellen Messtechnik – das Institut blickt in eine aussichtsreiche Zukunft.

Kosmologie-Auszeichnung für zwei Begründer der Inflationstheorie.

Der Hannoveraner Quantenforscher wurde gemeinsam mit dem Bonner Biochemiker Michael Famulok ins Präsidium gewählt.

Kerberos und Styx heißen der vierte und fünfte Plutomond nun offiziell.

Nach sechzig Jahren Neutronenforschung soll der Betrieb des Forschungsreaktors 2020 enden.

Richard Hildner erhält die internationale Auszeichnung für Nachwuchswissenschaftler für Arbeiten zur Photophysik.

Ultrarelativistische Positronenstrahlen eignen sich als Labormodell für die Erforschung astrophysikalischer Jets.

Thomson ISI haben ihren jährlichen Bericht veröffentlicht, Wiley-Journals verzeichnen Steigerungen.

Das ballongetragene Sonnenobservatorium absolviert die letzten Tests vor seiner einwöchigen Mission.

Der Rohbau des Stellarators ist nach wochenlangen, millimetergenauen Schweißarbeiten abgeschlossen.

Mit Vladimir Fortov steht ein Spezialist für Plasmaforschung und Raumfahrt an der Spitze der größten russischen Forschungseinrichtung.