
Planeten im Takt
Bestimmung der Umlaufperiode von Trappist-1h gelingt dank Planetenresonanz in Rekordzeit.

Bestimmung der Umlaufperiode von Trappist-1h gelingt dank Planetenresonanz in Rekordzeit.

Die „Highlights der Physik“ kommen im September nach Münster.

Neue Plattform vernetzt Mediziner, Forscher, Gerätehersteller und Patienten.

Exziton-Spins in Perowskit weisen vielversprechende Eigenschaften für zukünftige Spintronikanwendungen auf.

Plasmon-Eigenschaften gestapelter Graphen-Lagen lassen sich gezielt kontrollieren.
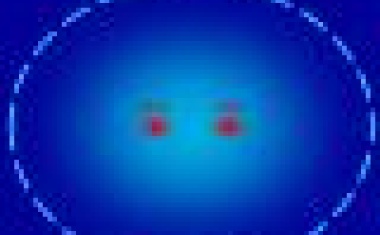
Neuer Ionisationskanal in molekularem Wasserstoff identifiziert.

Humboldt-Preisträger strebt vierdimensionale Visualisierung der Beschleunigungsprozesse an.
HZDR und Weizmann-Institut gründen Laser-Labor in Israel.

Planetenartiges Objekt wächst trotz geringer Masse ähnlich wie Sterne.
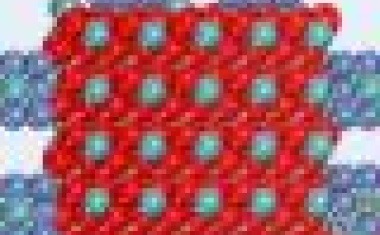
Funktionsmaterial eignet sich für die effiziente Produktion von molekularem Wasserstoff.

Simulationen zeigen markante Unterschiede zum glasartigen Erstarren von Schmelzen

Im neuen Rätsel von Physik in unserer Zeit geht es um einen Mathematiker mit bedeutendem Einfluss auf die Physik. Wir verlosen drei Buchpreise.
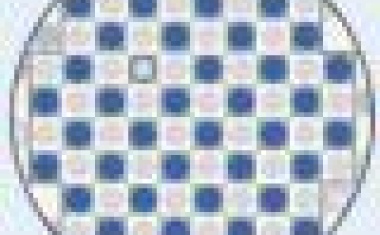
Mit ultrakalten Atomen in einem Lichtgitter auf der Suche nach neuer Physik.

Der „Jugend forscht“-Bundessieger in Physik von 2016, Ivo Zell, gewinnt den hoch dotierten Gordon E. Moore Award.
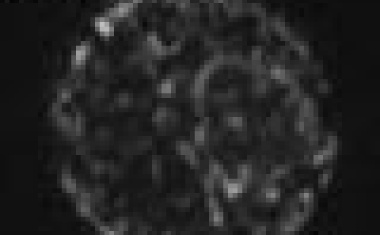
Neue Mikroskopiemethode vereinigt Lichtscheiben-Mikroskopie und kohärente strukturierte Beleuchtungsmikroskopie.

Heidelberger Centre for Advanced Materials heute feierlich eröffnet.

Cras id dui. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Quisque id odio.

Nanostrukturen ermöglichen eine genaue Intensitätsmessung über einen weiten Spektralbereich.

Nanostrukturen ermöglichen eine genaue Intensitätsmessung über einen weiten Spektralbereich.

Mechanische Verspannungen in zweidimensionalem Halbleiter dienen als Quellen für einzelne Photonen.

Ultradünne Ferrimagnete zeigen selbstorganisierende magnetische Zentren.

Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH liefert Zeitsignale nun auch als PTB-geprüfte gesetzliche Zeit.

Genau wie klassische Pendel können sich auch Quantensystem im gleichen Takt einschwingen.

Neuartiger Verbundwerkstoff für Windräder und andere Leichtbau-Anwendungen.

Absorptionsspektroskopie zur Strukturbestimmung und Beobachtung von Nanokristallen

Studie gibt Überblick über die neuesten Entwicklungen in der molekularen Spintronik.

Extrem geringe Radioaktivität im Detektor erleichtert die Suche nach Dunkler Materie.

Bis zu 100 Milliarden Mal pro Sekunde lässt sich zwischen Reflexion und Absortion wechseln.

Vergleich von Flusstälern auf Erde, Mars und dem Saturnmond Titan gibt Hinweise auf deren geologische Entwicklung.

Elektroden aus porösem Titanoxid schließen störende Polysulfide effizient ein.

Die ersten Gravitationswellen sind ins Netz gegangen, weitere werden folgen. Was bringt die Zukunft?

Physikalisches Verfahren macht den Einsatz von Bioziden überflüssig.

Überraschende Entdeckung vermittelt einen neuen Einblick, wie substellare Objekte entstehen.

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik präsentiert neue und effizientere Laserprozesse.

Experiment zeigt Quantenkorrelationen bis zur zehnten Ordnung.