
Silber in Singapur
Das deutsche Team gewinnt die Silbermedaille beim diesjährigen Physik-Weltcup IYPT.

Das deutsche Team gewinnt die Silbermedaille beim diesjährigen Physik-Weltcup IYPT.
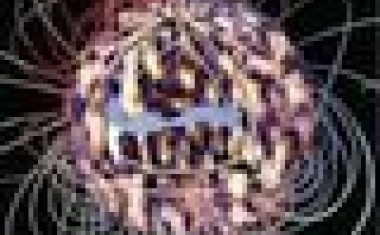
Magnetische Aktivität folgt gleichem Gesetz wie bei sonnenähnlichen Sternen.

Verfeinerte Elektronenstrahl-Lithographie ermöglicht Kontrolle über das Wachstum von winzigen Metallkristallen.

Überraschende Eigenschaften des Metalls Nickel könnten Entstehung des Erdmagnetfelds erklären.

Modellsystem für die atomgenaue Untersuchung von Reibungsphänomenen entwickelt.

Karsten Danzmann für Entwicklung der Laserinterferometrie ausgezeichnet.

Lernende Maschinen sagen die Eigenschaften von Röntgen-Impulsen voraus.

Gitter aus Gold-Nanopartikeln ermöglichen Laser mit einstellbaren Parametern.
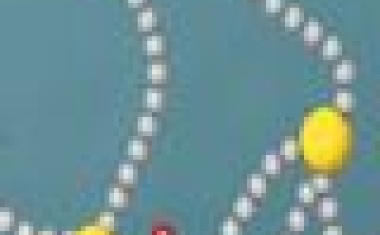
Dehnung auf tausend Prozent und Kompression auf die Hälfte – bei gleicher oder sogar höherer Kapazität.

Lasersystem an Bord eines Mikrosatelliten ebnet Weg für globales Quantenkommunikationsnetz.

Veränderungen im Eisengehalt beeinflussen Mikrostruktur von Samarium-Kobalt-Magneten.

Verhalten extrem kurzer Laserpulse während der Fokussierung beobachtet.

Ordnungsgrad der Flüssigkristalle reguliert Kavitation.
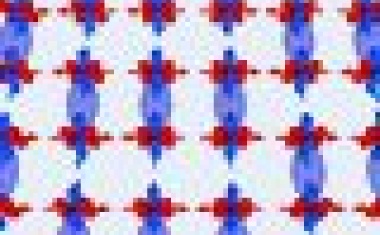
Phänomen der Elektronenpaare beobachtet.

FLUTE soll Elektronenwolken kompakt beschleunigen.

Cope-Umlagerung bei extrem tiefen Temperaturen beobachtet.

Halbtransparente organische Solarzellen in Brillengläsern versorgen Mikroprozessor mit Energie.

Entdeckung wirft neue Fragen zur Entstehung von Planeten auf.

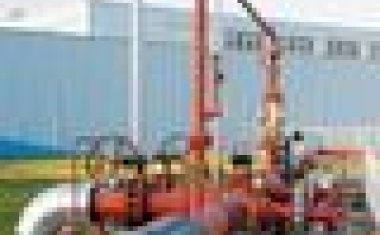
Messungen erlauben Rückschlüsse auf geologische Beschaffenheit geothermischer Reservoire.

Klassische Mechanik hilft bei der Steuerung von Quantencomputern.

Im neuen Rätsel von Physik in unserer Zeit geht es um einen Astronomen mit Hang zum Erklimmen von Bergen. Wir verlosen drei Bücher.

Zehn Millihertz Linienbreite – so nah an den idealen Laser kam noch keiner.
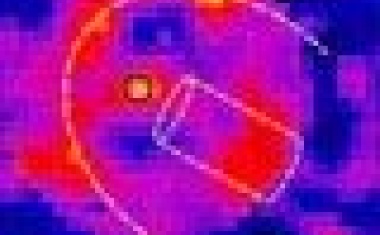
Infrarot-Beobachtungen liefern Hinweise auf Staubscheibe um Geminga-Pulsar

Inline Charakterisierung und Kontrolle der optischen Eigenschaften hochflexibler optischer Präzisionsschichten.

Erstmals einzelne Zusammenstöße von Atomen bei der Diffusion beobachtet.

Demo-Mission ROBEX nach fünf Jahren erfolgreich abgeschlossen.
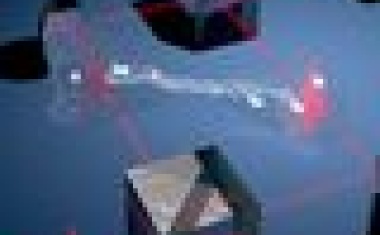
Halbleiter-Quantenpunkte unterbieten das Standard-Quantenlimit der optischen Interferometrie.
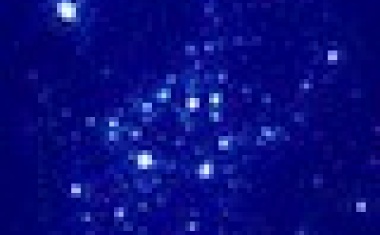
Neuartige Nanodiode nutzt elektrostatischen Effekt und zeigt bislang unerreichte Güte.

Der erste Spatenstich für den Ringbeschleuniger SIS100 markiert den offiziellen Baubeginn der internationalen Beschleunigeranlage FAIR in Darmstadt.

Neue Klasse veränderlicher Zwergsterne entdeckt.

Thomson ISI veröffentlichen jährlichen Bericht über die Impact Factors – Wiley-Journale verzeichnen erneut Steigerungen.

Kostengünstige Alternative zu Festkörperverstärkern.
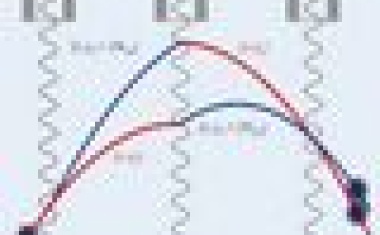
Laborexperiment mit Materiewellen sucht nach der dunklen Energie.

Mehrere Detektoren könnten die Effekte experimentell nachweisen.